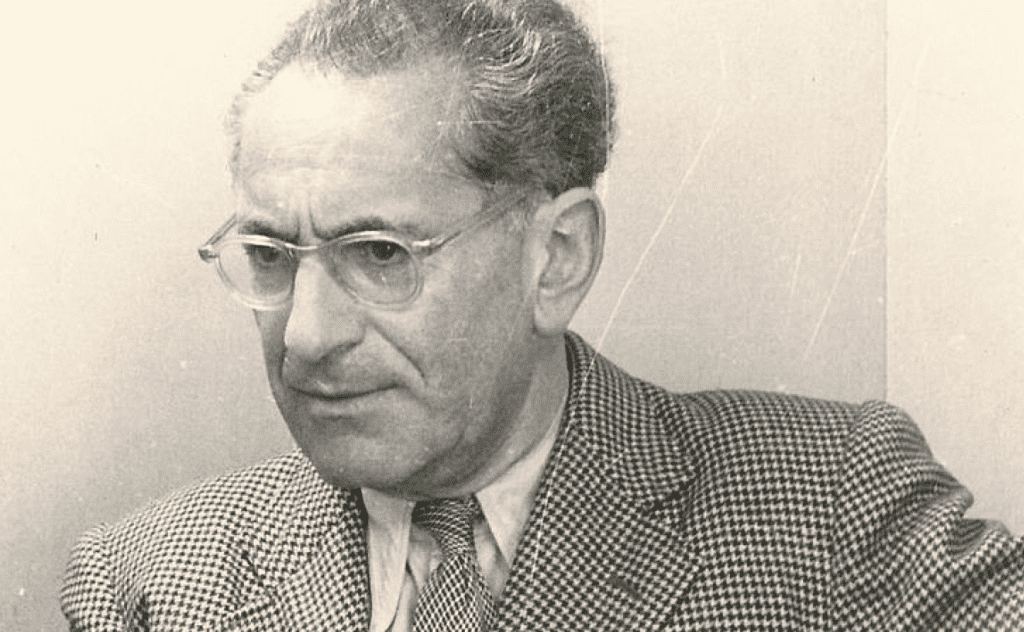Die Klasse 10e des Gymnasiums Große Schule erkundete im Rahmen einer Foto- und Geschichtswerkstatt das Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers in Schandelah. Das Zeitzeugengespräch am Ende des mehrtägigen Workshops zog die Wolfenbütteler Schülerinnen und Schüler in ihren Bann.
Jeder kennt die schrecklichen Film- und Fotoaufnahmen, die unmittelbar nach der Befreiung durch sowjetische Truppen im Konzentrationslager Auschwitz aufgenommen wurden. Die Zeitdokumente zeigen ausgehungerte, oft über viele Jahre körperlich und seelisch gequälte KZ-Insassen sowie Leichenberge. Sie spiegeln unendliches Leid wider. Doch dass nationalsozialistische Verbrechen nicht selten vor der eigenen Haustür stattgefunden haben, erfuhren Schülerinnen und Schüler der Klasse 10e des Gymnasiums Große Schule in Wolfenbüttel bei einer Erkundungstour über das Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Schandelah-Wohld. Geleitet wurde der mehrtägige, von der Braunschweigischen Stiftung und der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz geförderte Workshop von der Fotokünstlerin Yvonne Salzmann und dem Historiker Markus Gröchtemeier.
11 Kilometer lang, 2,5 Kilometer breit – Nordöstlich des Ortes Schandelah befindet sich das vermutlich größte zusammenhängende Ölschiefervorkommen in Deutschland. Angesichts des drastischen Engpasses in der Treibstoff- und Energieversorgung der deutschen Armee gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kamen die nationalsozialistischen Entscheidungsträger auf die Idee, aus diesem Sedimentgestein Treibstoff zu gewinnen. Somit war Schandelah erste Wahl für Abbau- und Forschungsarbeiten hinsichtlich des Schiefers. Aufgrund des Arbeitskräftemangels bedienten sich die Machthaber für die schweren Arbeiten der Häftlinge des KZ Neuengamme. Bis zu 800 KZ-Gefangene aus 15 unterschiedlichen Nationen bauten zwischen Herbst 1944 und dem 11. April 1945 bei Schandelah Ölschiefer ab.
Etwa 300 Männer unter anderem aus Frankreich, Belgien, Polen, Russland und Tschechien – darunter Widerständler und alliierte Kriegsgefangene – aber auch Deutsche fanden im Arbeitseinsatz unter grausamen Arbeits- und Lebensbedingungen sowie der schlechten Hygiene und Ernährungslage den Tod. Viele wurden Opfer der Gewalt der SS-Wachmannschaften – und wurden aus Willkür oder auf der Flucht erschossen. Die Spuren ihrer Taten verwischten die NS-Verbrecher: Mit herannahendem Kriegsende im Landkreis Wolfenbüttel wurden die Toten immer häufiger an einer Stelle im nahegelegenen Waldstück einfach so verscharrt.
Jeder der KZ-Häftlinge mit bloßen Händen – zehn bis zwölf Stunden täglich – einen Bahndamm aus dem Boden stampfen mussten. Eine Tortur für jeden Gefangenen, denn die über 20 Kilogramm schweren Bahnschwellen galt es Tag für Tag mit bloßen Händen zu tragen. Wie schwer dies ist, erfuhren die Schülerinnen und Schüler sehr anschaulich, indem sie zwei Wassereimer mit jeweils 10-Kilogramm-Gewichten in die Hände nahmen – und sich einige Meter fortbewegten. Im Waldstück erkannte die Geschichtsklasse der Großen Schule den ehemaligen Bahnlinienverlauf und fanden Überreste des Damms, der von einer Lorenbahn befahren wurde und die Verbindung vom Abbaugebiet und Bahnhof Schandelah herstellte, in Form von Schottersteinen.
Weiter ging es bei der Waldtour zu einer Stelle, an der der Ölschiefer heute noch sichtbar ist. Hier lernten die Workshop-Teilnehmer etwas über die Beschaffenheit von Ölschiefer – aber auch über die Ineffektivität des Prozesses: Aus 35 Tonnen Ölschiefermasse, die unter für die KZ-Häftlinge unmenschlichen Arbeitsbedingungen – teilweise mit bloßen Händen – gefördert wurden, konnte lediglich eine Tonne Treibstoff gewonnen werden. Und dieser funktionierte nur bei bestimmten Motorentypen. Tag eins endete nach einer Wanderung mit festem Schuhwerk zur neu angelegten Gedenkstätte KZ Schandelah-Wohld (an der Kreisstraße Richtung Scheppau) mit dem Gedenkstein mit der Aufschrift „Wir lernen nur, wenn wir nicht vergessen“, den ganz neuen Informationstafeln und am ehemaligen Abbaugebiet, das heute ein See ist.
Von dort aus ging es zu Fuß zu den Überresten des ehemaligen Ölschieferbrennofens in Form eines Betonskeletts, das heute wie ein Mahnmal mitten in der Landschaft steht, früher jedoch ein komplexes Forschungsprojekt darstellte. Über einen Feldweg gelangten alle zur ehemaligen Massengrabstelle im Wald. Die Grabstellen sind durch den leicht eingefallenen Boden heute noch gut erkennbar. Über hundert KZ-Insassen wurden hier, teilweise zu mehreren Personen auf einer Grabstelle, einfach so im Boden vergraben. Zu Beginn der 50er Jahre wurden die Toten exhumiert und in Särgen bestattet. Heute liegen über 100 zum Teil unbekannte Personen auf dem Friedhof Scheppau auf einem Ehrenfriedhof begraben.
„Wir möchten mit unseren Workshops Schülerinnen und Schülern die Ereignisse des NS-Unrechtsstaates näherbringen. Alle Workshop-Teilnehmer erhalten auf einem ‚Entdeckungspfad‘ einen historischen Einblick in das Thema KZ und Zwangsarbeit, beteiligen sich jedoch auch aktiv an der Spurensuche. Dies geschieht außer in archäologischer Weise insbesondere durch die Betrachtung durch den Sucher eines Fotoapparates“, berichtet Kursleiterin und Fotokünstlerin Yvonne Salzmann. „Jeder Teilnehmer berichtet und beschäftigt sich während des Projektes mit dem Thema und sucht sich dafür entsprechende Bilder und Motive. Die öffentliche Präsentation in Form eines Kataloges, der mit nach Hause genommen werden kann, dient als dauerhafte Dokumentation einer eigenen ‚Kunst- und Geschichtsproduktion‘.“
Bei einem zweiten Besuch in Schandelah interviewten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Kaffeerunde auf dem Hof von Marlis Krüger, die Mutter von Yvonne Salzmann, vier ältere Einwohnerinnen des Ortes, die sehr ehrlich und emotional über die Zeit des Nationalsozialismus und an Flucht und Vertreibung berichteten. Ein zweistündiges Gespräch, das die Klasse von Sandra Feuge tief beeindruckte.
Den Anfang hatte bereits vor drei Jahren die mehrtägige Geschichts- und Fotowerkstatt „Durchgeblickt – das KZ-Außenlager Schandelah-Wohld“ mit Kindern und Jugendlichen Mansfeld-Löbbecke-Stiftung gemacht. Beim bereits damals von der SBK geförderten Pilotprojekt hatten insgesamt sechs Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und 17 Jahren aus den Stiftungswohngruppen aus Goslar, aus Vienenburg und aus Hahnenklee – im Wechselspiel zwischen Dokumentation und Fotografie – sieben für das KZ Schandelah-Wohld historisch bedeutsame Stationen erkundet.
Zusammenarbeit
Das Modelprojekt erfolgte unter Einbeziehung der Schulen, der örtlichen Gemeindeverwaltung, der Politik, der Interessengruppen und Bevölkerung sowie der Arbeitsgruppe um Dr. Diethelm Krause-Hotopp, die sich bereits seit Beginn der 1980er Jahre mit dem Ausbau der Gedenkstätte für das KZ Schandelah befasst. Jedes Jahr findet Anfang Mai eine stets ergreifende Gedenkveranstaltung zum KZ Schandelah-Wohld statt – unter Teilnahme ausländischer Opferfamilien.
Fotos