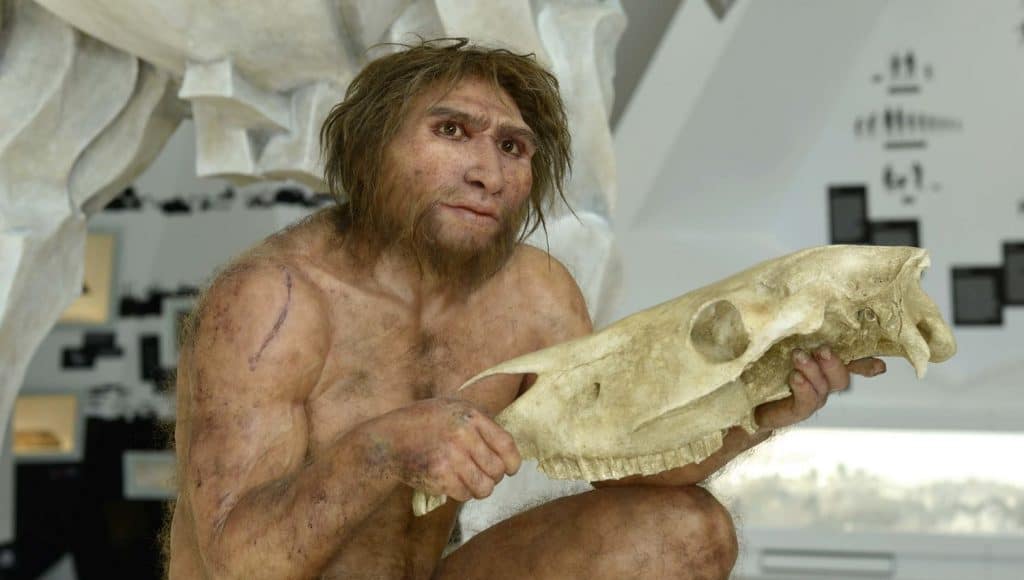Spurensuche im Helmstedter Braunkohlerevier: Wo ist das Gestern und wo ist das Morgen?
Verschwunden sind die Dörfer Alversdorf, Alt- Büddenstedt, Runstedt und Wulfersdorf. Sie mussten dem Braunkohlebergbau im Revier Helmstedt weichen. Jahrhunderte lang war der Kohleabbau die wirtschaftliche Kraft der Region um Schöningen. Verschwunden sind auch die riesigen Bagger, die sich in das Gelände fraßen. Angefangen vom „Trendelbusch“ (1874 – 1916) bis zu Schöningen Nord/Süd (1978 – 2016) sind alle zehn Tagebaue stillgelegt. Die 222 Jahre dauernde Geschichte des Kohlenbergbaus ist beendet. Das Gebiet soll zu einem Naherholungs- und Tourismusgebiet ausgebaut werden. Ist das die Zukunft? Im Zentrum steht dabei der Lappwaldsee. Die früheren Tagebaue Helmstedt (1973 – 2002) und Wulfersdorf (1936 – 1952) werden dazu geflutet. Voraussichtlich bis in die frühen 2030er Jahre wird das dauern.
Die Tour „Industrie verändert Landschaft. Eine Rundfahrt mit dem Fahrrad auf den Spuren der verschwundenen Orte“ am 22. Juli zeigt auf, was war, was ist und was wird. Der wahrlich nicht einfache Strukturwandel im Landkreis Helmstedt ist in vollem Gange. Kreisheimatpfleger Bernd Felgenträger begibt sich mit Landrat Gerhard Radeck auf Entdeckungsreise und lädt Interessierte ein. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der AG Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft und des Landkreises Helmstedt. Eine Sonderausstellung im Heimatmuseum Schöningen wird sich vom 10. August an zusätzlich mit dem Thema „222 Jahre Braunkohlegewinnung in der Region Ostafalen beschäftigen.
„Bis 2016 wurde eine Fläche von rund 40 Quadratkilometern vollständig verändert. Riesige Tagebaue entstanden und verschlangen Straßen, Eisenbahnlinien und ganze Dörfer, um anschließend wieder renaturiert zu werden. Ebenso wurden riesige Industriebauten errichtet und auch wieder abgerissen. Mit der Radtour wollen wir an die Standorte der Dörfer Alversdorf, Alt Büddenstedt und Runstedt führen und anhand alter Fotos darlegen, wie es dort früher aussah und wie sich das Landschaftsbild drastisch verändert hat“, sagt Felgenträger.
Einst arbeiteten 7.000 Menschen im Helmstedter Braunkohlerevier. Die Industriearbeitsplätze sind in der strukturschwachen Region mittlerweile komplett verschwunden. Jetzt geht es darum, den Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen. Ein Hoffnungsschimmer ist dabei der Tourismius. Mit „Trendelbusch“, „Treue“ und „Alversdorf“ sind drei Tagebaue schon verkippt. Bereits geflutet sind „Victoria“, „Jakobsgrube“ und „Anna“. Das ehrgeizigste Renaturierungsprojekt hat mit dem Lappwaldsee begonnen.
Während die beteiligten Bergbauunternehmen ihre bergrechtlichen Verpflichtungen zur Wiedernutzbarmachung des Geländes und zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit wahrnehmen, gehen die Planungen der Kommunen weit darüber hinaus. Der Lappwaldsee wird zu einem länderübergreifenden Erholungsgewässer entwickelt, an dem Baden, Wassersport, Angeln und Naturschutz verträglich miteinander kombiniert werden. Ein rund 16 Kilometer langes Wander- und Radwegenetz mit diversen Aussichtspunkten soll den See mit den umliegenden Dörfern und touristischen Zielen verbinden. Neben Strandbereichen, die zum Baden einladen, soll in Zukunft auf dem Lappwaldsee auch Surfen, Wasserski fahren und Regattasport möglich sein. Am nördlichen Aussichtspunkt Petersberg zwischen Schöningen und Hötensleben kann schon heute die entstehende Landschaft begutachtet werden.
Ob das den Bergbau als Wirtschaftsfaktor ersetzen kann? Die Braunkohlevorkommen um das heutige Helmstedt waren vor 50 bis 60 Millionen Jahren entstanden. Mit dem Abbau begann 1795 der Theologiestudent der Universität Helmstedt, Johann Moritz Friedrich Koch. Er legte die erste Helmstedter Kohlegrube in Form einer Schachtanlage an. Nach der Privatisierung der herzoglichen Braunkohlenwerke 1873 und der Gründung der „Braunschweigischen Kohlenwerke Helmstedt“ breiteten sich die Abbaugebiete schnell aus. Vor allem seit die Grube Trendelbusch – Runstedt an das Bahnnetz angeschlossen worden war, erlebte der Braunkohlenabbau einen großen Aufschwung. Er ging auch zu Lasten der verschwundenen Orte:
Alversdorf: Als das Dorf 1971 aufhörte, als selbstständige Gemeinde zu existieren, wohnten dort noch 324 Menschen. Sie wurden nach Schöningen umgesiedelt. Bereits Anfang der 1920er Jahre hatte es erste Pläne gegeben, das Dorf zugunsten des Braunkohle-Tagebaus Alversdorf abzureißen. Von 1940 an durfte dort nicht mehr neu gebaut werden. 1962 wurde der Tagebau schließlich aufgeschlossen, 1967 begann der Abriss des Dorfes, der 1974 beendet wurde. 1991 war der Tagebau Alversdorf ausgekohlt. In Alversdorf befand sich ein Hallenbad, das von den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke AG (BKB) betrieben wurde. Es wurde mit der Abwärme des Kraftwerks „Treue“ beheizt. Der Eintritt war kostenlos.
Alt-Büddenstedt: Bereits Mitte der 1930er Jahre begann die Umsiedlung der ersten Bewohner, weil unter dem Ort wertvolle Kohle lagerte. Die Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke beschlossen den Bau von zunächst 100 Siedlungshäusern auf „kohlefreiem“ Gelände in der Nähe von Büddenstedt. Vor allem während des Zweiten Weltkrieges wurde der Abriss des alten Dorfes forciert, die Rüstungsindustrie brauchte Kohle. Im Jahre 1941 verschwand der Friedhof, die Gräber waren allerdings schon 1938 in die, wie man damals sagte, „Siedlung Büddenstedt“ umgebettet worden. Am Karfreitag des Jahres 1943 wurde die Kirche gesprengt. Die letzten Bewohner verließen im Dezember 1947 kurz vor den herannahenden Baggern ihre Häuser.
Runstedt: Das Dorf stand auf tagebauwürdiger Kohle und wurde in das Abbaugebiet des Tagebaus „Treue“ einbezogen. Bereits seit 1893 hatte die Brikettfabrik Trendelbusch ihr Geschäft dort errichtet. Das letzte Runstedter Gebäude wurde im Oktober 1972 abgerissen. Es war die alte Holländer-Windmühle. Sie lag allerdings außerhalb des eigentlichen Ortes. Der Abriss der Wohnhäuser hatte bereits 1958 begonnen und war zehn Jahr später abgeschlossen. Im Mittelalter hatte sich der Stammsitz der namensgebenden Adelsfamilie von Runstedt in dem Ort befunden.
Wulfersdorf: Das erste Dorf, das im heutigen Landkreis Helmstedt dem Braunkohletagebau weichen musste, war Wulfersdorf. Zum Zeitpunkt des Abrisses von 1940 bis 1945 gehörte das Dorf zur Gemeinde Harbke. Der Tagebau Harbke/Wulfersdorf wurde 1909 aufgeschlossen. Bis 1952 war er in Betrieb. 1919 lebten in Wulfersdorf 118 Personen. 1840 war dort beim Bau eines Brunnens erstmals Braunkohle entdeckt worden. Der Graf Röttgen von Veltheim ließ daraufhin nach Braunkohle schürfen. 1842 folgte der erste kleine Tiefbau mit Namen August Ferdinand 1. Auf dem Gebiet befindet sich heute eine Deponie, so dass die Radtour den ehemaligen Ort nicht beinhaltet.
Die Radtour:
Anmeldung unter E‑Mail: sommertour@landkreis-helmstedt.de oder unter der Telefonnummer (05351) 121‑1118. Anmeldungen bis spätestens 17. Juli. Für die Verpflegung fällt ein Kostenbeitrag von 10 Euro an. Die Fahrt ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen.”
Treffpunkt: 38364 Schöningen. Parkplatz am Schloss
Länge und Dauer: ca. 35 km und 4 ‑5 Stunden
Die Ausstellung:
Start: 10. August, 16 Uhr
Ort: Heimatmuseum Schöningen, Markt 33, 38364 Schöningen
Öffnungszeiten: Mittwoch 15 – 17 Uhr, Samstag: 10.30 – 12.30 Uhr, Sonntag: 14 – 17 Uhr.
Führungen außerhalb der Öffnungszeiten: 05352–50838
Fotos