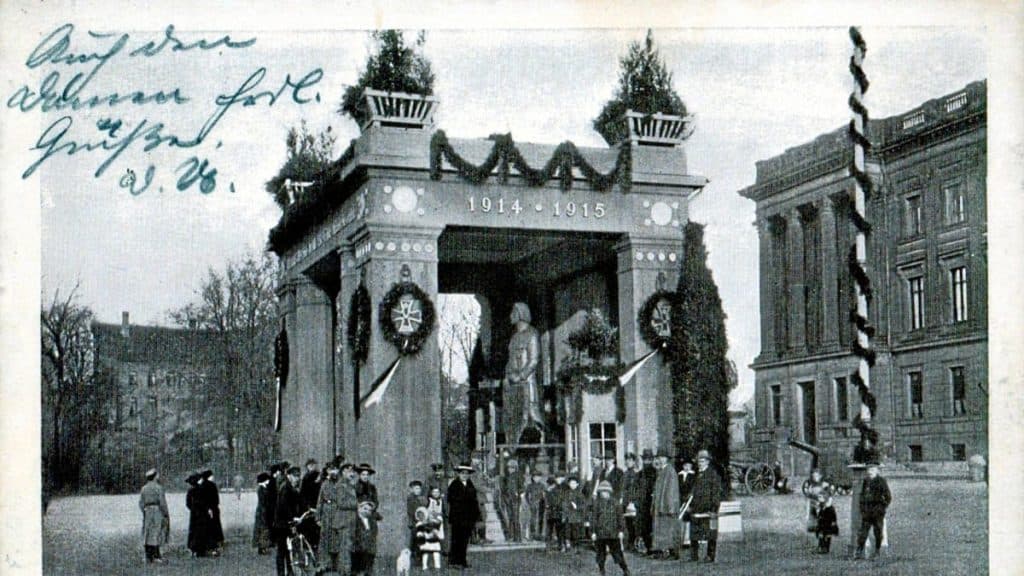Der 1364 Seiten starke Katalog „Mittelalterliche Münzen“ des Herzog Anton Ulrich Museums zählt fast 10.000 Zahlungsmittel.
Um 9955 mittelalterliche Münzen zu katalogisieren, benötigt man eine Engelsgeduld. Viel wichtiger jedoch: Spezialwissen in Numismatik. Ansonsten sollte man lieber die Finger von derartiger Herkulesarbeit lassen. Prof. Dr. Wolfgang Leschhorn, der Leiter des Münzkabinetts des Herzog Anton Ulrich-Museums (HAUM) und in der Vergangenheit Lehrbeauftragter in Basel, Wien und Salzburg hat das Abenteuer gewagt. Der Experte nahm innerhalb von vier Jahren sämtliche Münzen und Silberbarren des herzoglichen Museums aus der Zeit von 491 nach Christus bis ins 16. Jahrhundert unter die Lupe. Auf dem Tisch seines Büros in der HAUM-Außenstelle Burg Dankwarderode liegt ein zweibändiger Bestandskatalog mit dem Titel „Mittelalterliche Münzen“.
Exakt 1364 Seiten kamen am Ende heraus, eine Fundgrube für alle Mittelalterhistoriker, Landeshistoriker, Kunsthistoriker aber auch Numismatiker, Sammler und Münzhändler, wie bereits viele Rezensenten in Fachzeitschriften betonten. Kommentare und Literaturhinweise runden das Fleißwerk ab. Gestaltet wurden die beiden dicken Bände von Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart, die sich 10 Monate mit dem Layout beschäftigten und so einen tiefen Einblick in die Gestaltung wissenschaftlicher Publikationen gewannen.
„Braunschweig war ein Zentrum für mittelalterliche Numismatik“, sagt Prof. Dr. Leschhorn, der heute an der Technischen Universität Braunschweig und als Honorarprofessor in Leipzig lehrt. Dies fußt auf der Tatsache, dass die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel bereits im 17. Jahrhundert Münzen sammelten. Die erste Ausstellung bei der Eröffnung des neu gegründeten Kunst- und Naturalienkabinetts 1754 war – wie sollte es anders sein – eine Münzenschau. „Daniel de Superville, der erste Direktor des Braunschweiger Museums unterrichtete die herzöglichen Söhne in Numismatik. Er lehrte sie Geschichte über die Münzen“, so Leschhorn. Und zwei Jahre nach der Eröffnung des Vorläufers des Herzog Anton Ulrich-Museums fiel auch ein wichtiger Schatzfund am Ägidienkloster, als Münzen des Herzogs Heinrich der Löwe zu Tage kamen.
Zwischen dem Jahr 1000 und 1550 sind 51 Schatzfunde mittelalterlicher Münzen dokumentiert. Der Großteil der Mittelaltermünzen, die im nord- und mitteldeutschen Raum gefunden wurden, fand im 18. und 19. Jahrhundert den Weg in die herzoglichen Magazine. Paul Jonas Meier, der Leiter des herzoglichen Museums von 1886 bis 1924, ergänzte die Mittelalterbestände durch gezielte Zukäufe aus dem Münzhandel, in Auktionen und aus Privatsammlungen, wie die berühmter Sammlungen des Generals von Graba, Arthur Löbbeckes und Emil Bahrfeldts. Heute verfügt das HAUM über eine der größten Sammlungen mittelalterlicher Münzen in Deutschland.
Mehr als 400 Münzprägestätten gab es in Mitteleuropa, sogar eine im Heiligen Land. „Im Königreich Jerusalem haben die Kreuzfahrer ihre eigenen Münzen geprägt“, so Prof. Dr. Leschhorn, der zuvor die griechischen und römischen Münzen des imposanten HAUM-Bestandes publizierte. Die älteste Münze, eine Byzantinische, datiert auf das Jahr 491 nach Christus. Man muss kein Geschichts-Proseminar besucht haben, um zu wissen, dass in der Forschung um dieses Jahr der Übergang von der Antike ins Mittelalter vonstatten ging. Chronologisch geht der Katalog im vorderen Teil vor: Ostgoten, Langobarden, Angelsachsen, Wikinger, Merowinger und Karolinger hatten ihre ganz eigenen Zahlungsmittel. Unter dem Braunschweiger Herzog Heinrich der Löwe vollzog sich Mitte des 12. Jahrhunderts ein Wandel: Die so genannten Brakteaten (Braktia = dünnes Silberblech) wurden nur noch einseitig geprägt. Nimmt man diesen Münzentypus der Folgejahrzehnte in die Hand, muss man aufpassen, dass er nicht zwischen den Fingern zerbröselt. Schwer indes ist ein etwa handgroßer Silberbarren aus dem 14. Jahrhundert, der tief eingeprägte sogenannte Gegenstempel zeigt nicht nur die Herkunft, sondern garantiert auch die Echtheit.
Dass sehr viele mittelalterliche Urkunden gefälscht sind, ist hinlänglich bekannt. Kriminelle Energie gab es jedoch auch im Münzgeschäft: Ausgerechnet der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) hatte dafür gesorgt, dass der Medailleur Nicolaus Seeländer (1683–1744) in Hannover als Kupferstecher und Hofmaler angestellt wurde. Seeländer hatte Zugang zu großen Münzkabinetten und Privatsammlungen. Er fälschte viele Brakteaten, machte sie zu Geld. Einige davon landeten im Bestand des Herzog Anton Ulrich-Museums. Erst rund 100 Jahre später kam man dem cleveren Fälscher auf die Schliche. 182 Brakteaten-Fälschungen konnte Leschhorn und Forscher vor ihm enttarnen, sie sind ebenfalls im Katalog enthalten. Im Vorwort des Kapitel Fälschungen heißt es: Sie sind als Warnung für unbedarfte Sammler alle abgebildet.
Fakten
Wolfgang Leschhorn: Mittelalterliche Münzen, 2 Bände, 1364 Seiten, Format 21 cm x 29,6 cm, Braunschweig 2015
Preis: 49,90 Euro
ISBN: 978–3‑922279–71‑6
Erhältlich: Herzog Anton Ulrich-Museum (Museumstraße 1, 38100 Braunschwieg, info.haum@3landesmuseen.de), örtlicher Buchhandel, Münzhandel