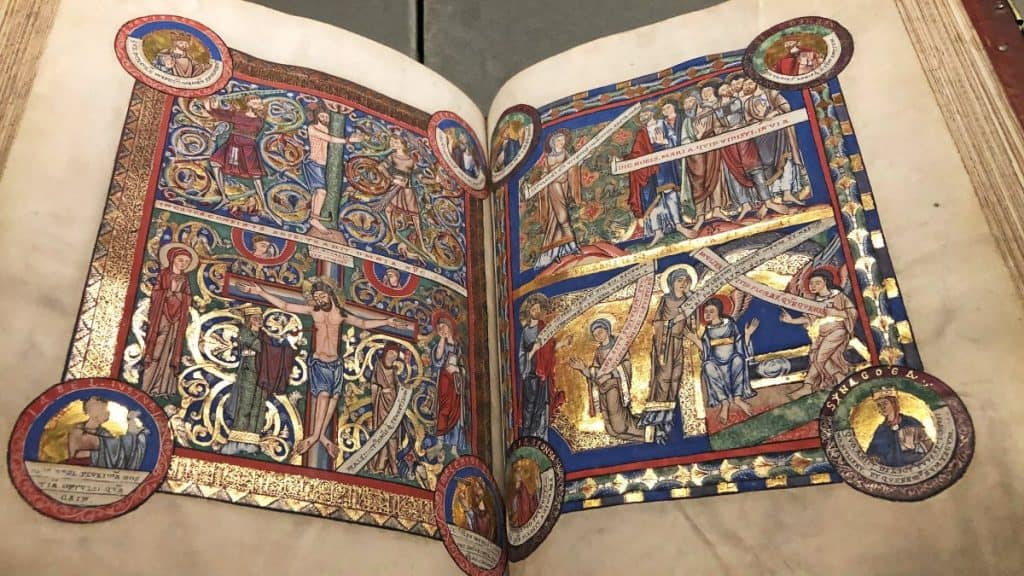TU-Studenten erforschen den Innenhof des Biozentrums: Was heißt es für die Artenvielfalt, wenn die Pflege gegen Null geht?
Aberhunderte von ihnen soll es in Braunschweig geben: Hinter- und Innenhöfe, die eher wild als adrett wirken und förmlich nach Aufwertung schreien. Doch ist das notwendig? Studenten der TU wollten es genauer wissen. Der Innenhof den Biozentrums wurde untersuchte. Es stellte sich heraus: Kleine Paradiese müssen nicht adrett, sie können auch wild sein.
Betritt man den Innenhof des Biozentrums von der Spielmannstraße aus, ist man sofort der Meinung: So können das die Planer einst unmöglich gewollt haben. Und das hätten sie auch nicht gewollt, sagt Lucas Well. Das Biozentrum ist sein Arbeitsplatz. Man möchte meinen: So eine Untersuchung, wie ökologisch wertvoll ein Innenhof ist, sollte für Biologen eine Kleinigkeit sein. Tatsächlich ist Well Doktorand für Molekular-Genetik mit dem Arbeitsschwerpunkt Schimmelpilz-Mutanten. TU-Biozentrum, erzählt er, das stehe für Untersuchungen an der DNA und Proteinen. Bestimmung der Artenvielfalt, „das ist weitestgehend Neuland“.
 Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 5.6.2023
Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 5.6.2023
Und dennoch steht nun nach einem Jahr auf der fast 400 Quadratmeter großen Fläche eine Info-Tafel, die deutlich mache, so Well: „Niemand soll auf die Idee kommen, alles platt machen zu wollen. Der Innenhof ist ein höchst wertvoller Lebensraum – trotz aller Veränderungen.“ Mühsam haben Well und zehn Studierende, unterstützt von vier Experten, die Fläche erforscht. Wie sie vor 35 Jahren genau aussah, was sich die Innenhof-Planer dachten, ist nicht genau bekannt. Ein einziger Zeitzeuge fand sich aber.
Vom alten Innenhof blieb wenig übrig
Mittlerweile weiß man: Im Innenhof wuchsen einst 16 Robinien. Über die Jahre sind 15 von ihnen verschwunden. Es gab vier kleine Teiche. Drei davon wurden zugeschüttet. Das rechteckige Wasserbecken am Innenhof-Rand wurde einst regelmäßig mit Wasser aus einer Quelle bei Königslutter gefüllt. Eine gleichmäßige Wasserqualität war wichtig, weil dort die Auswirkung von Pestiziden auf Köcherfliegen untersucht wurde. „Experimente eines Instituts, das es längst nicht mehr gibt“, erzählt Well.
Was es gibt, ist ein ganz spezieller Lebensraum, den Well so beschreibt: „Der Boden ist äußerst karg und nährstoffarm. Gewässert wird nicht, die Backstein-Fassaden der umliegenden Institute speichern Hitze. Schatten gibt es kaum. Die sporadische Pflege hat das Ziel, die Wege frei zu halten und zu verhindern, dass alles zuwuchert.“ Längst wachse dort nicht alles, was man sich wünscht. Gut gemeinte Versuche von Studenten und Wissenschaftlern, durch zusätzliche Pflanzen den Artenreichtum zu erhöhen, endeten in der Regel ergebnislos. Der Innenhof ist als Lebensraum ganz besonders.
Stock-Enten fühlen sich dort dennoch wohl. Ein Pärchen brütet in einer Hecke der Zell-Biologie im ersten Stock des Biozentrums. Der Nachwuchs kann bei ersten Schwimmübungen im Wasserbecken beobachtet werden. Am Teich trinken Insekten. Wie man alles das erforscht und auf einer Infotafel zusammenfasst, dazu gab es schließlich eine Lehr-Veranstaltung mit Referaten von Studenten.
Artenvielfalt übertrifft Erwartungen
Die Ergebnisse fielen völlig anders als erwartet aus, wie Zell erläutert. „Wir hatten zum Beispiel geglaubt: Es sind bestimmt drei oder vier verschiedene Wildbienen-Arten anzutreffen. Tatsächlich wurden binnen zwei Stunden 26 verschiedene Arten gezählt. Unser Wildbienen-Experte ist der Ansicht: Der Innenhof ist wohl Lebensraum für etwa 35 verschiedene Arten.“ Warum, wisse man nicht, sagt Zell: „Kleingärten gibt es in der Umgebung keine. Der stark befahrene Rebenring ist nur 200 Meter entfernt.“
Ähnlich bei den Pflanzen. Bambus oder Hortensien gab es schon immer und sind auch Laien geläufig. Andere Pflanzen wurden per Handy-App bestimmt. Experten prüften nach und schlossen Lücken. „Am Ende waren es 46 verschiedene Arten, die den Innenhof erobert haben.“ Magerrasen-Pflanzen wie der Kleine Wiesenknopf. Oder Buntklee und Habichtkraut. Kronenwicke oder Mauerpfeffer. Was trocken- und hitzeresistent ist, das überlebt im Innenhof.
Datenbasis für weitere Untersuchungen entsteht
Mittlerweile sind die letzten Hürden genommen, eine Info-Tafel aufstellen zu dürfen. Die Einwilligung der fünf benachbarten Institute wurde eingeholt. Das Corporate Design der TU galt es zu beachten. Das Sandkasten-Logo musste auf die Tafel. Sandkasten ist eine Initiative der TU, um studentische Projekte zu fördern. Von dort kamen auch die 650 Euro für die Info-Tafel. Natürlich sei das viel Geld, sagt Zell: „Aber die Kollegen haben gesagt: Kauft bloß keinen Billig-Schrott. Die Info-Tafel muss viele, viele Jahre UV-beständig bleiben und lesbar sein.“
Zumal sich auf der Tafel auch ein QR-Code befindet. Er führt zu einer Internetseite, wo all die Pflanzen und Wildbienen aufgelistet sind, die gefunden wurden. Grund sei, erklärt Zell: „Das ist eine Datenbasis. Sollte in fünf oder zehn Jahren die Bestimmung wiederholt werden, wüsste man, wie sich unser Innenhof verändert hat.“
 Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 5.6.2023 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article238579637/Braunschweig-Ein-kleines-Paradies-wird-sichtbar.html
Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 5.6.2023 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article238579637/Braunschweig-Ein-kleines-Paradies-wird-sichtbar.html