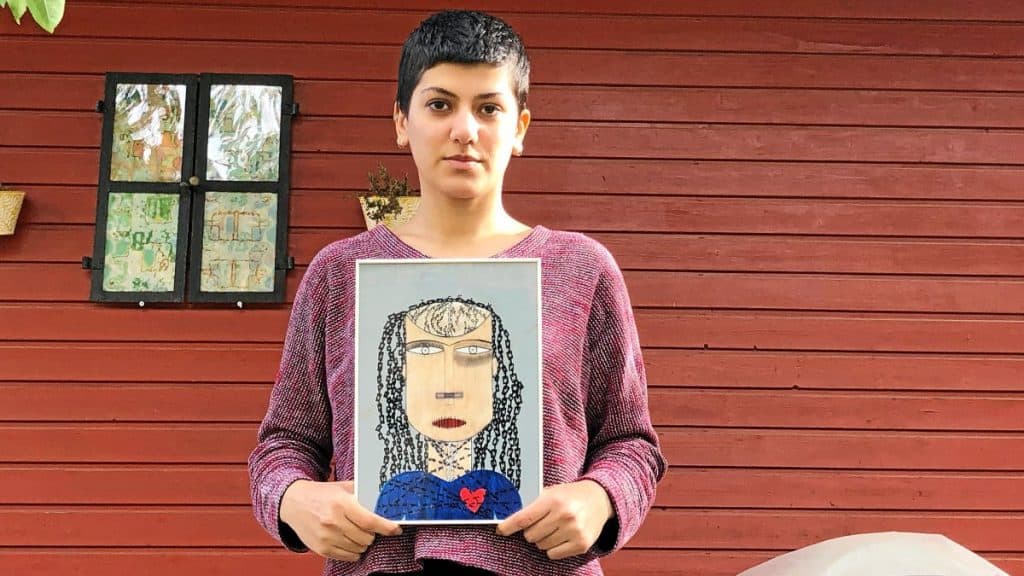Aus dem Stadtarchiv, Folge 3: Gegen 1166 ließ Herzog Heinrich das Löwenmonument als selbstbewusstes Zeichen seiner Ansprüche errichten.
Das Braunschweiger Symbol schlechthin ist der Löwe. Da verschlägt es nichts, dass es Löwen auch an anderen Orten gibt. Denn in Braunschweig wirken mächtige Traditionen. Herzog Heinrich hatte im 12. Jahrhundert als Herzog von Bayern und Sachsen eine königgleiche Stellung inne. Das brachte er provokant zum Ausdruck, indem er sich mit dem Löwen, dem König der Tiere, identifizierte. Ego sum Hinricus Leo: Ich bin Heinrich, der Löwe. Gegen 1166 ließ er das Löwenmonument im Braunschweiger Burgbezirk errichten, ein sehr selbstbewusstes Zeichen seiner Ansprüche und seiner Möglichkeiten.
Die Stadt Braunschweig setzte ein Abbild dieser Skulptur in ihr Siegel. Aber zum Wappen wählte sie einen aufrechten roten Leu mit hochgestrecktem Schwanz. Die Herzöge hingegen entfernten sich mit ihren Symbolen von der einfachen Monumentalität des Standbildes. Zwar führten auch sie, namentlich als Regenten, bis ins 15. Jahrhundert einen schreitenden Löwen oder Leoparden in ihren Siegeln, doch zeigen ihre Wappen statt des einen zwei schreitende Löwen, die sie aus dem englischen Königswappen übernommen hatten.
Kaiserlicher Wappenbrief
Als die Stadt sich ihren Löwen 1438 durch einen kaiserlichen Wappenbrief bestätigen ließ, bedeutete das auch eine Herausforderung der Herzöge, die (aus anderen Gründen) vermehrt das braunschweigische Pferd verwendeten. Den Wappenbrief und viele Abdrücke der städtischen Siegel bewahrt das Stadtarchiv Braunschweig. Quellen über die Errichtung des Standbildes fehlen leider.

Aus dem Stadtwappen leiten sich viele Verwendungen ab. Die Zahl der Abbildungen und grafischen Verwendungen ist, beginnend mit dem Siegel des Stifts St. Blasii und dem Wappen des Braunschweiger Weichbildes Sack, fast unüberschaubar. Der Braunschweiger Turn- und Sportverein „Eintracht“ nahm 1895 den roten Löwen des Stadtwappens in einfachem rotem Kreis als Emblem an. Auf das Löwenstandbild hingegen bezog sich zum Beispiel die Firma Heinrich Büssing in ihrem Logo, auf dem sich der Löwe – gegen die Gepflogenheiten der Wappenkunst – nach rechts richtet. Die Firma MAN SE übernahm 1971 mit Büssing auch dieses Markenzeichen, das sich seither auf dem Kühlergrill aller von MAN produzierten Nutzfahrzeuge findet.
Streit mit dem Land
Um das Eigentum am Löwenstandbild kam es 1983/1984 zu einem Streit zwischen der Stadt, die das Kunstwerk 1982 für 500.000 D‑Mark hatte restaurieren lassen, und dem Land Niedersachsen als Rechtsnachfolger der Herzöge. Besonders erboste die Braunschweiger die Überlegung der Landesregierung, den Löwen nach Bonn auszuleihen. Zur Restaurierung 1982 liegen Akten im Stadtarchiv Braunschweig und im Nachlass das Landeskonservators Dr. Kurt Seeleke im Landesarchiv.
Der Streit wurde nicht gerichtlich ausgetragen, sondern politisch beigelegt. Der echte Burglöwe steht vorübergehend im Herzog Anton Ulrich-Museum. Wegen der Sperrung der Ausstellungsflächen in der Burg Dankwarderode musste die Mittelaltersammlung umziehen. Vom 5. März nächsten Jahres an werden rund 80 Prozent der kostbaren Kunstwerke in eigens dafür hergerichteten Ausstellungsräumen wieder für Besucher zugänglich sein. Sowohl das HAUM als auch die Burg sind Gebäude des Landes, aber die Stadt hat deshalb ihre Ansprüche natürlich nicht aufgegeben.
Wirkung ungebrochen
Die Wirkung des Löwen ist im Braunschweiger Land nach wie vor stark: In einer Podiumsdiskussion, die sich 2016 mit dem Löwen als Symbol und „Code der Macht“ beschäftigte, erklärte Braunschweigs Ehrenbürger und früherer Ministerpräsident Niedersachsens Gerhard Glogowski auch mit Blick nach Hannover: „Aus dem Löwen ziehen wir unsere Kraft!“
Dr. Brage Bei der Wieden leitet das Niedersächsische Landesarchiv Abteilung Wolfenbüttel. Der Beitrag erschien zuerst im Buch „Von Asse bis Zucker. Fundamente Braunschweigischer Regionalgeschichte“.
Mit unserer Reihe „Aus dem Stadtarchiv“ wollen wird unsere Leserinnen und Leser auch auf das Jubiläum zum 1000-jährigen Bestehen Braunschweigs im Jahr 2031 vorbereiten. Anlass dafür ist die Ersterwähnung der Stadt in der Weiheurkunde der Magnikirche von 1031.