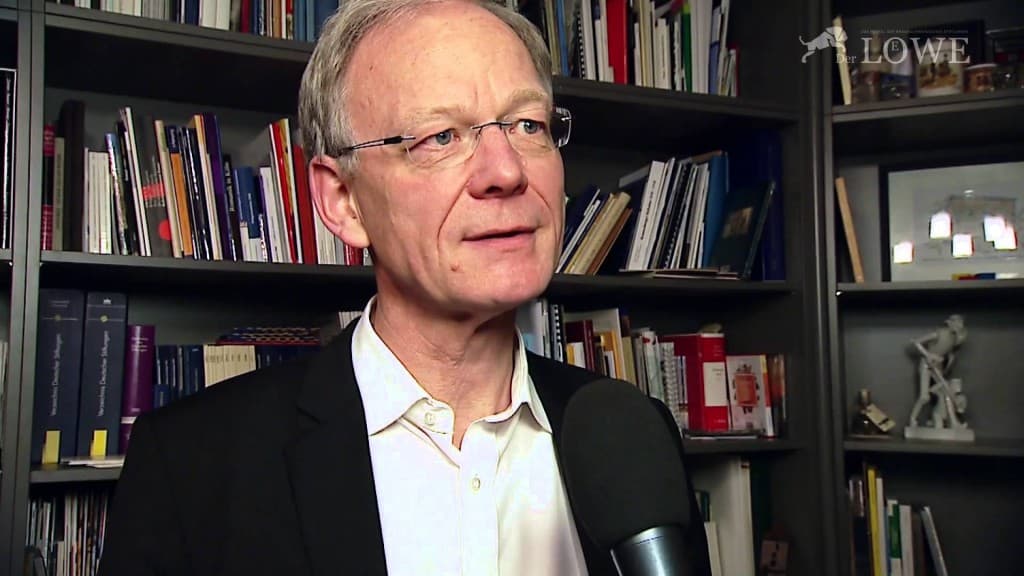Objekt des Monats, Folge 15: Ein Braunschweiger Glanzstück aus dem 18. Jahrhundert.

Möchte man sich in dem ca. einen Meter hohen Wandspiegel aus der Zeit um 1750 betrachten, gestaltet es sich als Herausforderung. Denn sobald man davorsteht, fällt der Blick zunächst auf den kunstvoll gestalteten Rahmen, der mit einer lebhaften floralen Ornamentik verziert ist. Bis auf die großen Ranken im vierteiligen Giebel im oberen Bereich und auf den beiden Seitenrändern, wurden die symmetrisch angeordneten Muster – darunter Streublumen, Früchte, Stängel und Blätter – rückseitig in das Glas eingeschnitten. Dennoch wirken sie, als wären sie von vorne eingeschliffen, was dem Spiegel eine faszinierende Tiefe verleiht. Nicht zuletzt entsteht dadurch ein faszinierendes Spiel zwischen Glanz und Schatten, dem auch die blinden Stellen, die sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben, kaum etwas anhaben können.
Glaskunst aus Meisterhand
Das mundgeblasene, aus gestreckten Glaszylindern bestehende Spiegelglas wurde in der Fürstlichen Spiegelglashütte Grünenplan am niedersächsischen Hils, der einzigen Spiegelglashütte im Herzogtum Braunschweig, gefertigt und dort vermutlich auch geschliffen poliert. Für die weitere Verarbeitung versandte man die Glasplatten per Kurier – gut in Holzwolle eingepackt – in die Braunschweiger Hofspiegelmanufaktur Thomas Körblein (um 1713–1753), die einst in der Nähe des Steintores gelegen war. Hier wurden sie mit Zinnfolie bzw. Quecksilber belegt und verziert.
Wie u. a. auch die Fürstenberger Porzellanmanufaktur oder die Glashütte zu Schorborn, gingen diese beiden Unternehmen ebenfalls aus dem Bestreben des Braunschweiger Herzogs Carl I. (1713–1780) hervor, die Kultur und Wirtschaft in seinem Herrschaftsgebiet zu fördern und zu stärken. Die 1744 gegründete „Fürstliche Spiegelglashütte auf dem Grünen Plan“ ist heute Teil der Schott AG, die weltweit vor allem für die Herstellung von Spezialglas und Glaskeramik bekannt ist.
Die künstlerische Verzierung des Wandspiegels geht auf Johann Heinrich Balthasar Sang (geb. 1723) zurück, dessen Signatur unten links am Spiegel zu sehen ist. Der aus einer berühmten thüringischen Glasschneiderfamilie stammende Glaskünstler, der die Kunst der Glasveredelung von klein auf bei seinem Vater Andreas Friedrich Sang erlernte, wurde im Jahr 1747 von Carl I. zum Herzoglichen Hofglasschneider berufen. Als namhafter Meister des Glasschnittes veredelte er in Braunschweig bis mindestens 1764 Glaserzeugnisse mit verspielten Ornamenikmustern, figürlichen Darstellungen und Landschaften. Dazu gehörten vor allem Pokale, aber auch Glasplatten für Spiegel sowie Schränke und Uhrengehäuse. Meist nutzte er dafür Kupferstiche oder von ihm auf Papier gezeichnete und signierte Vorlagen.

Spiegel als Luxus- und Statussymbol
Als Luxusgüter waren Spiegel dieser Art nahezu ausschließlich für die Ausstattung adeliger Räume bestimmt. Auch konnten sie als reiner Wandschmuck dienen, indem die glatte Spiegelfläche in der Mitte mit figürlichen Darstellungen oder Landschaften – ähnlich einem Gemälde – verziert wurde. So wünschte sich beispielsweise Carl I. für die Gastgemächer seines Schwagers, König Friedrich der Große, im Schloss Salzdahlum etwas Besonderes. Nach einem Kupferstich des italienischen Künstlers Jacopo Amigoni (1682 –1752) aus der berühmten Serie „Die vier Elemente“ schuf Johann Heinrich Balthasar Sang eine Darstellung in der Mitte der Spiegelfläche, die er rückseitig eingravierte. Dem Geschmack der Zeit entsprechend, wurden die Darstellungen gern auch uminterpretiert und abgewandelt.
Neben dem Stück aus der Sammlung der Richard Borek Stiftung sind heutzutage nur wenige Stücke erhalten geblieben. Bis zum 31. August 2025 kann der Wandspiegel in der Sonderausstellung „ResidenzWechsel“ im Weißen Saal des Schlossmuseums Braunschweig betrachtet werden.