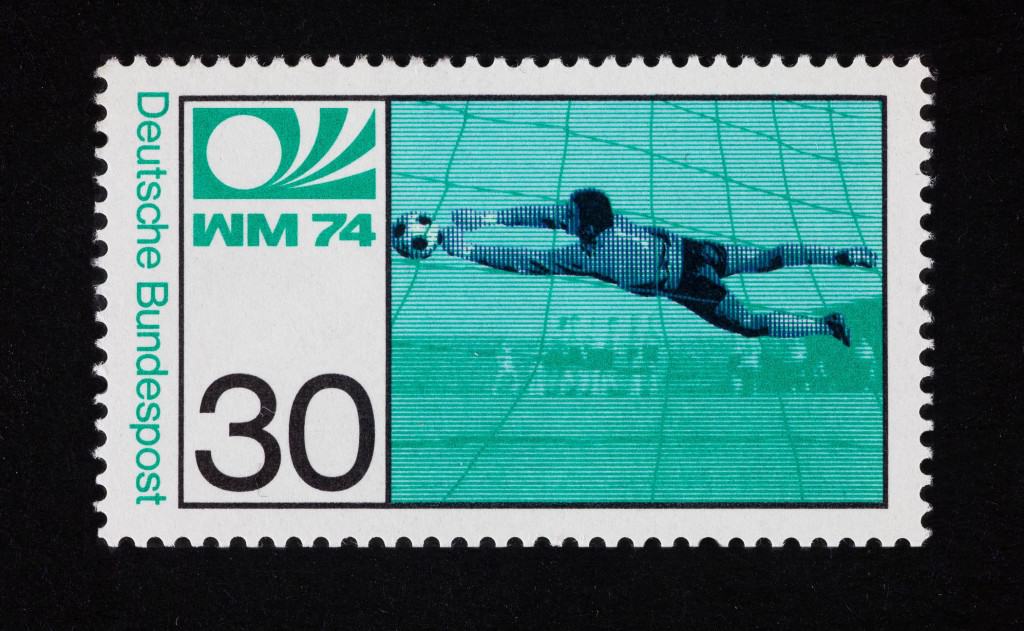Ehrenbürger der Stadt Braunschweig, Folge 1: Carl Friedrich Gauß.
Joachim Heinrich Campe (1746–1818) wurde neben Friedrich Schiller unter anderem 1792 Ehrenbürger Frankreichs. Dr. Heinrich Dohrn (1838–1913) erhielt 1904 die Ehrenbürgerwürde von Stettin/Szczecin. Herzog Wilhelm von Braunschweig (1806–1884) wurde in Hietzing (heute Bezirk von Wien) 1861 als Ehrenbürger gewürdigt. Posthum schließlich ernannte der damalige Gouverneur Bill Clinton im Jahr 1957 Friedrich Gerstäcker zum Ehrenbürger von Arkansas. Braunschweiger mit höchsten Ehren versehen wurden Botschafter auch ihrer Heimat. Mit diesen Beispielen wollen wir die Betrachtung zu Braunschweigs Ehrenbürgern und Ehrenbürgerinnen eröffnen, denn auch für die Stadt Braunschweig gilt:
Höchste Auszeichnung der Stadt
Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts stellt die höchste Auszeichnung dar, die von der Stadt Braunschweig vergeben werden kann. Sie wird allgemein an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Stadt in einzigartiger Weise verdient gemacht haben. Dabei können die zugrunde gelegten Voraussetzungen vielfältig sein und sind ein Spiegelbild der jeweiligen Stadtgesellschaft. So waren die ersten Verleihungen seit dem Jahr 1838 durch den Konkurrenzkampf der Messestandorte Braunschweig und Leipzig angestoßen worden, orientiert an genau definierten Leistungen von Kaufleuten für die Braunschweiger Messe, aber im Zuge der Industrialisierung auch zunehmend mit Verdiensten für Industrie und Wirtschaft verbunden. Weitere Verdienstkriterien waren und sind herausragende wissenschaftliche, kulturelle, politische und soziale Leistungen.
Besonderes Forschungsprojekt
Ehrenbürger stellen eine besondere Kategorie kommunaler Würdenträger dar, deren geschichtliche Bedeutung und Lebenswege als idealtypisch für die Verbindung von Bürgerlichkeit, Regionalität und Biografik zu erforschen ist. Diese Gruppe kommunalstaatlich und gesellschaftlich einflussreicher Persönlichkeiten stellt ein weitgehendes Desiderat in der Kultur- und Regionalgeschichte dar.
In einem Forschungsprojekt am Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte (IBRG) der TU Braunschweig arbeiten Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel und Dr. Angela Klein in Kooperation mit dem Stadtarchiv Braunschweig zum Thema Ehrenbürgerwürde, um die Lebenswege dieser Ehrenbürger und Ehrenbürgerinnen zunehmend in den Fokus der städtischen und regionalen Öffentlichkeit zu rücken. Vorab sollen schrittweise Beiträge im Internetportal „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ erste Vorstellungen ermöglichen.
Beginnen wollen wir mit dem vierten Ehrenbürger der Stadt Braunschweig aus dem Jahr 1853, der erstmals aufgrund seiner persönlichen und wissenschaftlichen Wirkungsmächtigkeit geehrt wurde: Carl Friedrich Gauß (1777–1855).

Zahlreiche Förderer
Am 30. April 1777 wurde der berühmteste Sohn der Stadt Braunschweig, Carl Friedrich Gauß, geboren. Der „Fürst der Mathematiker“ verdankte zunächst alles, was er in der Wissenschaft erreichte, sowohl seinen genialen Anlagen als auch zahlreichen Förderern in Braunschweig. Anekdoten und Legenden ranken sich um die Jugendzeit des großen Mathematikers, der gerne den Spruch zitierte, er habe als Dreijähriger „eher rechnen als sprechen gelernt“, und man erfährt, dass Gauß als Kind beim Spielen fast ertrunken wäre. Aber er hat diese Gefahr überlebt und bereits in der Schule wurde seine mathematische Gabe erkannt.
Mit Förderung des braunschweigischen Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand (1735- 1806), der auch Lessing und Spohr unterstützte, konnte Carl Friedrich Gauß nach einem Besuch am Braunschweiger Collegium Carolinum (1792–1795) sein Mathematikstudium (1795–1798 in Göttingen absolvieren. Es war dies ein besonderes Privileg, denn die braunschweigischen Landeskinder mussten zunächst an der welfischen Landesuniversität in Helmstedt studieren. Nach seiner Promotion bei dem Helmstedter Mathematiker Professor Johann Friedrich Pfaff am 16. Juli 1799 vollendete Gauß sein erstes großes Werk „Disquisitiones arithmeticae – Untersuchungen über höhere Arithmetik“, das 1801 erschien, und mit dem er die moderne Zahlentheorie begründete.
Längst war Gauß auf vielen Feldern der Naturwissenschaften und der Mathematik wissenschaftlich erfolgreich tätig, denn Herzog Carl Wilhelm Ferdinand bot dem Wissenschaftler, der äußerst ungern Vorlesungen hielt, die Möglichkeit als Privatgelehrter in Braunschweig seinen Forschungen nachzugehen. Er wurde angemessen bezahlt, gefördert und von Lehrverpflichtungen freigestellt.
Auch als Astronom erfolgreich
Mit der Bahnbestimmung der Ceres, des ersten am 1. Januar 1801 entdeckten Planetoiden, machte sich Gauß in der Astronomie einen hervorragenden Namen. Als er 1802 einen Ruf an die Sternwarte nach St. Petersburg erhielt, lehnte er trotz des großzügig bemessenen Angebotes ab, da der braunschweigische Herzog nicht nur das Gehalt des Privatgelehrten erhöhte, sondern zugleich Peter Joseph Krahe beauftragte, für Gauß und seine astronomischen Forschungen eine eigene Sternwarte zu planen. Trotz zahlreicher Abwerbungsversuche, zum Beispiel aus Göttingen, schien die wissenschaftliche Laufbahn des Gelehrten in Braunschweig klar bestimmt.
Die politische Katastrophe des Jahres 1806, der Tod von Herzog Carl Wilhelm Ferdinand in der Schlacht von Jena und Auerstedt/Hassenhausen und die Besetzung des Landes durch die Franzosen, veränderten den Lebensweg von Gauß. Eine berufliche Existenz im universitären Bereich konnte für ihn nicht in Frage kommen und die Förderung als Privatgelehrter fand ihr Ende.
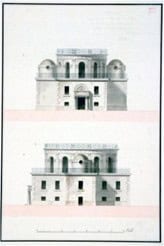
Vermittlung nach Göttingen
Während Gauß sich bemühte, eine Anstellung an der Universität St. Petersburg zu erhalten, hatten sich Freunde, wie der Bremer Astronom Olbers, um Vermittlung an die Universität Göttingen bemüht. Als Carl Friedrich Gauß am 21. November 1807 in Göttingen eintraf, konnte er nicht ahnen, dass dies der Ort für den zweiten und ebenfalls bedeutenden Lebensabschnitt werden sollte.
Er war nun Professor für Astronomie und gemeinsam mit seinem Kollegen Ludwig Harding (1765–1834) Direktor der Sternwarte, deren Neubau im Entstehen war. Neben Mathematik und Astronomie arbeitete Gauß auf vielen Wissenschaftsgebieten erfolgreich, so in der Geodäsie und der Physik. Gemeinsam mit dem 1831 nach Göttingen berufenen Physiker Wilhelm Weber (1804–1891) forschte er auf dem Gebiet des Magnetismus und der Elektrizität. Diese fruchtbare Zusammenarbeit endete, als Weber aus politischen Gründen 1837 entlassen worden war und 1843 einen Ruf nach Leipzig annahm.
Viele Angebote abgelehnt
In der Folgezeit widmete sich Gauß fast ausschließlich seinen mathematischen Forschungen. Es gab kaum eine mathematische Disziplin, die nicht von ihm entscheidend beeinflusst und gefördert worden war. Auch die Hannoversche Landesvermessung verdient eine Erwähnung. In Göttingen blieb Gauß bis zu seinem Tod am 23. Februar 1855 trotz zahlreicher Angebote anderer Universitäten wie Leipzig und Dorpat oder der Berliner Akademie, die ihn als Gründungsdirektor für eine neu zu gründende Polytechnische Schule (heutige TU) gewinnen wollte.
Gauß bewahrte sich stets eine gute Erinnerung an seine Heimatstadt Braunschweig. Diese ehrte den „größten Sohn der Stadt“ zu dessen Goldenem Doktorjubiläum 1849 mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. In seinem Dankesbrief vom 5. August 1849 betonte Gauß „das Interesse an Allem, was meine liebe Vaterstadt angeht“, und meinte, die Jahre in Braunschweig gehörten „zu denjenigen Abschnitten meines Lebens, auf die ich, wie in so vielen Beziehungen, so auch in wissenschaftliche, mit einer eigentümlich bewegten Befriedigung zurücksehen muss“.