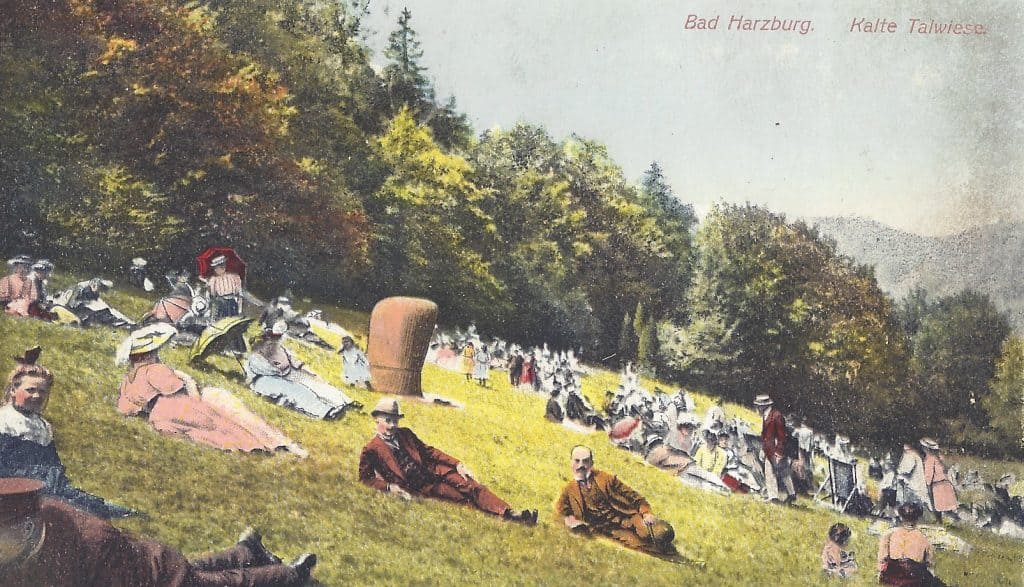Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 22: Den Ritter und das Einhorn wollten die Braunschweiger nicht haben.
Das Ende des Raabe-Brunnens auf dem Magnikirchplatz im Bombenhagel des 14. Oktober 1944 kennzeichnet symbolisch den Untergang der ideologischen Verirrung der Zeit mit Ideen, die heute nicht wieder erwachen dürfen, auch wenn die Gefahr sichtbar groß ist. Denkmäler sollen erinnern, sind Quellen der Geschichte und sollen nicht der Verherrlichung von Personen oder Ereignissen dienen. Sie können aber zum Nachdenken und zur Mahnung hilfreich sein. Das 1975 an gleicher Stelle errichtete Denkmal für Wilhelm Raabe in Braunschweig hat diese Wandlung des Denkmalgedankens deutlich werden lassen. Anstelle des Ritters mit Schwert und Einhorn von 1931 steht nun ein Satz aus Raabes Werken, mit dem der Dichter einst fast prophetisch in die Ferne blickte: „Hütet Euch fernerhin, Eure Hand zu bieten, noch mehr der Ruinen zu machen“.
Initiative eines Münchners

Es war schon eine besondere Geschichte, bis auch Braunschweig seinem 1910 verstorbenen Ehrenbürger Wilhelm Raabe ein Denkmal errichtete. Erste Planungen durch Louis Engelbrecht begannen gleich nach dem Tod Raabes, jedoch verhinderten der Erste Weltkrieg und die Inflation der 1920er Jahre die Umsetzung. Schließlich wurde durch die Initiative des Münchener Anwalts Dr. Thaddäus Abitz-Schultze von der „Gesellschaft der Freunde Raabes“ 1925 ein neuer Anlauf genommen und ein Denkmalausschuss gegründet. Neben zahlreichen Honoratioren der Stadt Braunschweig gehörten ihm unter anderem auch Konrad Adenauer, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Ricarda Huch an. Schirmherr war Reichspräsident Paul von Hindenburg.
Dieser Ausschuss veröffentlichte einen Aufruf, um dem „deutschesten der deutschen Dichter“, der mit anderen Großen das bittere Los hatte teilen müssen, „bis in sein hohes Alter in seinem künstlerischen und vaterländischen Wirken und Wollen von seinem Volke verkannt zu werden“, ein Denkmal zu setzen. Die „Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes“, die 3.500 Mitglieder zählte, habe beschlossen, ihrem Meister durch Errichtung eines würdigen Denkmals zu seinem 100. Geburtstage, dem 8. September 1931, diese Dankesschuld abzutragen (Dresdner Nachrichten v. 16. September 1926).
Sagebiels Entwurf scheiterte
Schließlich fiel die Wahl unter den 17 eingesandten Entwürfen auf den des Münchener Professors Behn. Der favorisierte Entwurf des hiesigen Künstlers Karl Sagebiel wurde trotz der Unterstützung aus Braunschweig selbst nicht berücksichtigt. Der Münchner Thaddäus Abitz-Schultze hatte sich gegen heftigen Widerstand durchgesetzt.
Ein Medienkampf um Platz, Gestaltung und Wirkung war vorausgegangen. Fritz Hahne hatte 1929 in der Braunschweigischen Landeszeitung (BLZ) die Forderung an die „Idee Raabe-Denkmal“ noch einmal zusammengefasst: „Aber wir verbitten uns für ein Denkmal Raabes plumpe Vertraulichkeit, ebenso wie irgendwelche Beziehungen auf Einzelstellen seiner Werke ausgeschlossen sind. Groß und monumental, wie er im Innersten war, soll er dastehen in Bronze für Jahrhunderte, und zwar in seiner vollen Reife als der getreue Eckart des deutschen Volkes, zu dem er sich immer mehr auswachsen wird. Deshalb können wir auch ein Jugendbild Raabes, womöglich bartlos als Verlobter oder Jungverheirateter, schlechterdings nicht als geeignet ansehen. Den Raabe kennt niemand. Erst mit dem 70. Geburtstage ist Raabe durch Engelbrechts und Brandes’ Verdienst allgemein in Deutschland bekannt geworden. In dieser Gestalt will ihn das deutsche Volk, wollen ihn nicht nur seine Braunschweiger Freunde, sehen“.
Nicht als Raabe-Denkmal akzeptiert
Behns Entwurf mit einem krönenden Einhorn auf einem Brunnen wurde demzufolge sehr kritisch gesehen. Wie konfliktreich die ganze Situation war, verdeutlicht eine Pressestimme aus der BLZ vom 3. Juli 1930: „Es gibt bereits Raabe-Brunnen, und wenn Braunschweig das Behnsche Kunstwerk erhalten haben wird, dann wird es einen Raabe-Brunnen mehr geben. Wo aber bleibt das Raabe-Denkmal, das große bezwingende, das Raabe-Denkmal, das die Krönung der Hundertjahrfeier nächsten Jahres sein soll? Der Behnsche Brunnen ist eine romantisch gedachte Sache. Wir und die Zukunft wollen uns aber doch keineswegs mit der romantischen Seite Raabes begnügen. Wo bleibt bei dem Behnschen Entwurf die in das Kommende unseres Volkes weisende Größe des Dichters, die gerade in den letzten Jahren mehr und mehr erkannt worden ist?“
National-konservatives Gedankengut
Bereits am Aufruf der „Gesellschaft der Freunde Raabes“ war erkennbar geworden, mit welchem national-konservativen Gedankengut die Ideenträger begonnen hatten, Wilhelm Raabe für ihre Ziele zu instrumentalisieren. Da überrascht es nicht, dass sich aus diesem Denkmalausschuss die Keimzelle zum eigenständigen „Verein Raabe-Stiftung“ entwickelte, der seit dem 8. September 1931, dem Tag der Denkmalsweihe in Braunschweig, den „Kampf gegen alles Undeutsche im Schrifttum“ führte und als Schrittmacher nationalsozialistischer Kulturpolitik wirkte. Es dauerte bis in die 1960er Jahre, ehe die Raabe-Gesellschaft sich von diesem Schaden wieder befreien konnte.
Weitere Informationen zu Wilhelm Raabe:
www.der-loewe.info/meine-strasse-meine-schule-mein-museum
www.der-loewe.info/gerd-biegel-bleibt-praesident-der-raabe-gesellschaft