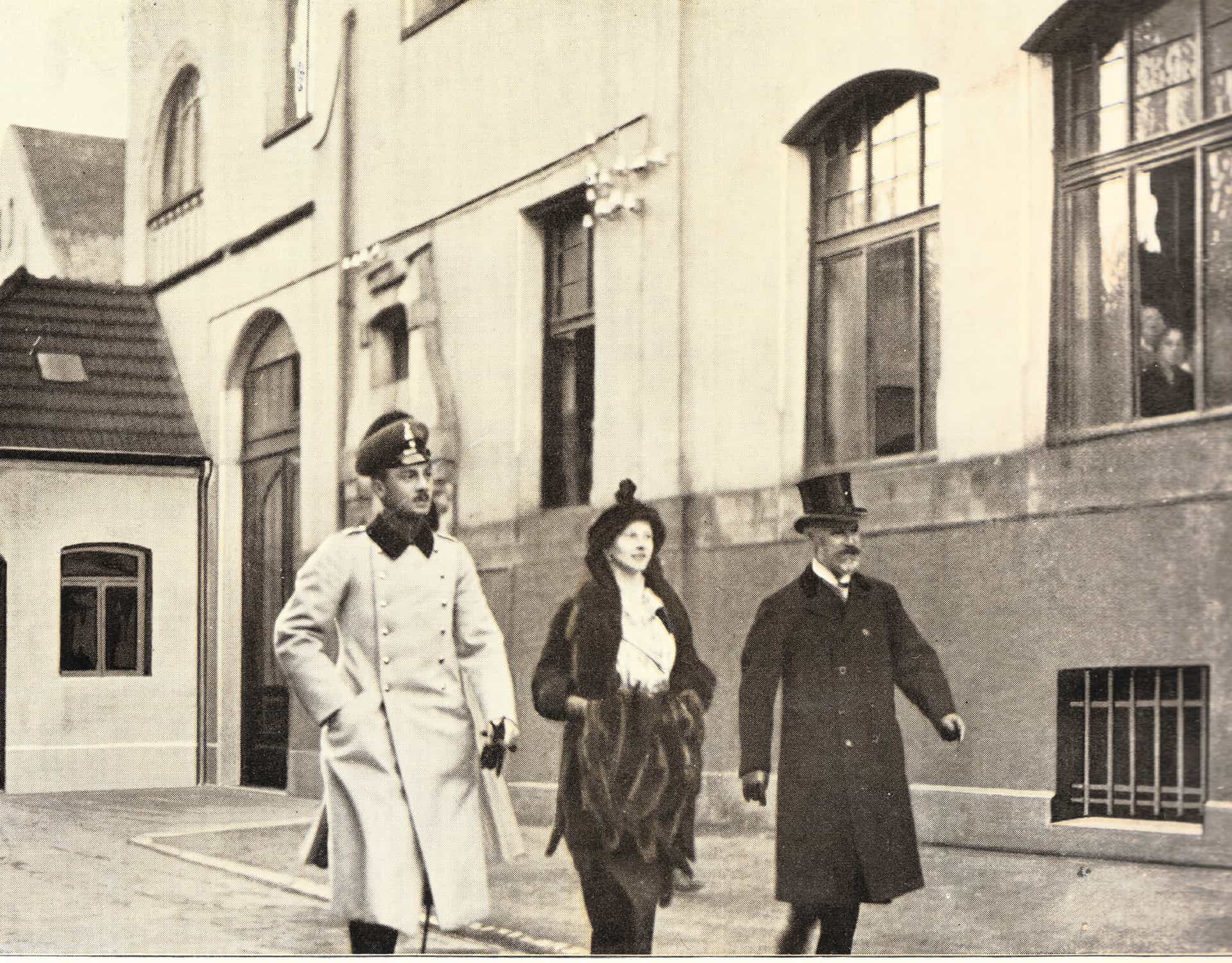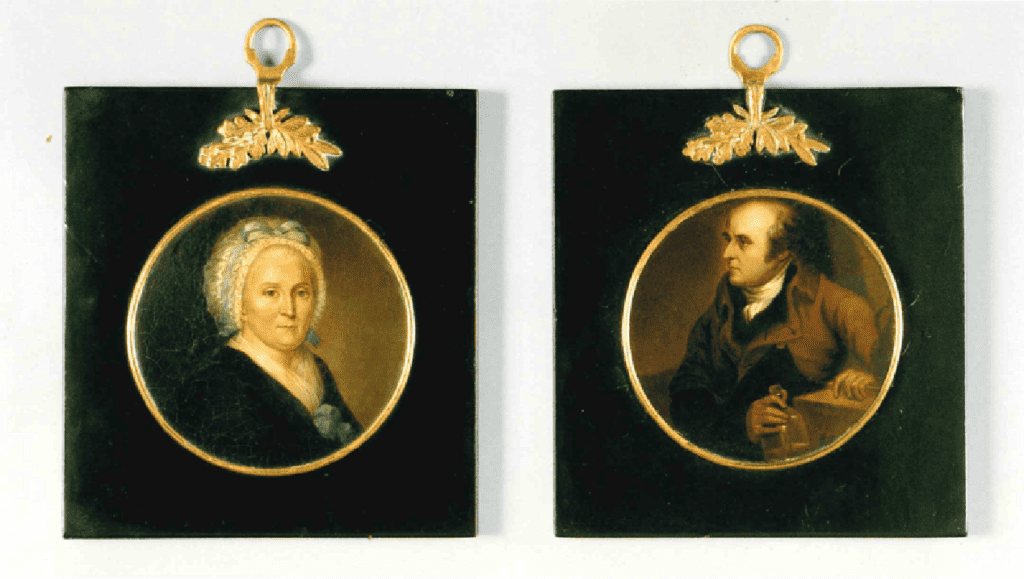Folge 2 der Serie zu den Ereignissen im Braunschweiger Land und den Kriegsschauplätzen von 1914–1918.
Während die Soldaten an den Fronten die Schrecken des Krieges erlitten, lief in der Heimat die Kriegsproduktion auf Hochtouren. Frauen ersetzten die kämpfenden Männer in der Produktion und im täglichen Leben. Sie arbeiteten in den Fabriken und fuhren z.B. Straßenbahnen. In der Region Braunschweig waren während der Kriegszeit bis zu 400 Unternehmen in die Rüstungsproduktion eingebunden – und machte blendende Geschäfte.
Ein Beispiel sind die Braunschweiger Büssing-Werke. Schon vor Kriegsbeginn war Büssing auf die Belieferung des deutschen Heeres mit kriegstauglichen Lastwagen gut vorbereitet. Bereits 1907 hatte Generalmajor Alfred Freiherr von Lyncker, Inspekteur der Verkehrstruppen, den Wert dieses Transportmittels für die militärische Logistik erkannt. Das Kriegsministerium legte deshalb 1908 ein Subventionsprogramm für Lastwagen auf. Büssing gehörte zu den vier Firmen im Reich, die so genannte Subventionslastwagen bauen durften. Bei 7,5 Tonnen Gesamtgewicht mussten die Lastwagen 16 km/h schnell sein und eine Reichweite von 250 Kilometer mit einer Tankfüllung haben. Unternehmen, die einen Subventionslastwagen kauften, erhielten vom Staat 4000 Mark (etwa 20 Prozent des Anschaffungspreises) beim Kauf sowie jährlich 1000 Mark Betriebskostenzuschuss.
1908 erhielten die Braunschweiger außerdem von der Heeresverwaltung den Auftrag, ein benzin-elektrisches Fahrzeug zu bauen. Vorbild war das Produkt eines jungen Ingenieurs aus Wien. Er hieß Ferdinand Porsche. In einer zeitgenössischen Büssing-Werksschrift heißt es: „Ferner bestellte die Heeresverwaltung noch einen benzin-elektrischen Lastzug, bei dem auf dem Maschinenwagen selbst die elektrische Kraft mittels zweier Büssing-Motoren von 50 bis 60 PS erzeugt wurde.” Büssing baute daraufhin 1908 einen elektrischen Lastzug mit fünf Anhängern, die über 18 PS starke Radnabenmotoren angetrieben wurden. Die Zugmaschine hatte zwei 60 PS starke Motoren, die gleichzeitig den Siemens-Generator zur Stromerzeugung antrieben. Büssing setzte die Hybrid-Zusammenarbeit mit Siemens übrigens sehr erfolgreich beim Bau von benzin-elektrischen Schiffsantrieben fort.
Durch das Subventionsprogramm konnte das Heer bei Kriegsbeginn auf einen großen Fundus von Lastwagen zugreifen. Die Produktion bei Büssing lief auf Hochtouren. Die Braunschweiger lieferten Lastwagen für den Kriegseinsatz, die zum Teil auch für den Schienenbetrieb umgerüstet werden konnten, schwere Schlepper für das Gelände, ein Vielzahl von Sonderfahrzeugen und auch einen gepanzerten Wagen. Der Büssing Panzerwagen hatte zwei Fahrerstände und konnte so ebenso schnell vorwärts- wie rückwärtsfahren. Bestückt war er mit vier Maschinengewehren.
Während die Soldaten in verlustreiche Kämpfe verwickelt waren, wurde die Versorgungslage daheim immer problematischer. Das Stadtarchiv Braunschweig bewahrt einen Karton voller Bezugsmarken für beispielsweise Lebensmittel, Kleidung, Petroleum und Pflegemittel wie Seife auf. Für Personen mit ansteckenden Krankheiten gab es Seife und Waschpulver extra – allerdings nur auf amtsärztliche Bescheinigung. Und für Kinder bis 18 Monate durfte eine Zusatzseife bezogen werden.
Um die Ernährung in der Stadt zu verbessern, eröffnete Mitte 1915 am Alten Eiermarkt die AVG (Abfall-Verwertungsgesellschaft). Ihr Zweck: Die Annahme von Küchenabfällen, Brotresten, Knochen, Kartoffelschalen, aber auch alle leeren Konservendosen. Im Aufruf heißt es: „Bringt sie sauber und frisch den Kaninchen, Hühnern und Schweinen für die unter Futternot leidenden Viehhalter.” Der Aufruf zeigte Wirkung: Täglich 25 bis 30 Zentner Kartoffelschalen brachten die Kinder zur Sammelstelle. Sie bekamen Gutscheine – für 100 Gutscheine gab es ein Kaninchen.
In der Stadt wurde ein Liebesgaben-Ausschuss gegründet, der Spenden für die Soldaten an der Front sammelte. Laut Liste des Ausschusses waren besonders gefragt: Zigarren, Zigarillos, Zigaretten, Tabak, Kautabak, Brieftaschen, Spiegel, Taschentücher, Handtücher, Taschenmesser, Zahnbürsten, Hosenträger, Fußlappen, Feldpostkarten, Briefpapier, Füllfederhalter und vieles mehr.
Die Zeitung „Braunschweiger Allgemeiner Anzeiger – Verbreitetste Braunschweiger Zeitung” rief zu einer Sammlung der besonderen Art auf: Sie bat um Spenden von „Ferngläsern und Pistolen für Unteroffiziere”. In Anzeigen boten Braunschweiger Geschäfte wetterfeste, warme Kleidung für den Schützengraben an sowie Köstritzer Schwarzbier als Nähr- und Kraftbier für die verwundeten Krieger.
Die Kinos zeigten heroische Werke mit Titeln wie „Die Einbringung der eroberten französischen Kanonen”, „Im Flugzeug über Paris”, „Freuden der Reserveübung – eine tolle Militärhumoreske”, „Die letzte Abnahme der Königsulanen Hannover durch unseren Kaiser” aber auch Unterhaltungsfilme wie z.B. „Der ungetreue Albert” mit der Erläuterung: „Sehr originell – Deutscher Humor – Deutsche Schauspieler”.
Der Braunschweiger Flotten-Verein sammelte für die Besatzung des Linienschiffes “Braunschweig” mit markigen Worten in einer Anzeige :” …Und welcher Deutsche wird jetzt nicht alles tun, um unsere Blaujacken gesund und tüchtig zu erhalten, für den Kampf , welcher unserer Flotte noch bevorsteht, der Niederwerfung Englands, dieses Rädelsführers und Drahtziehers der verbündeten feindlichen Mächte.” Was der Seemann braucht, wussten der Flotten-Verein natürlich auch: “…auch sind bei kalter stürmischer Nacht die Zutaten zu einem wärmenden Punsch sicher nicht unwillkommen.”
Das Linienschiff “Braunschweig” war 1904 bei der Germaniawerft in Kiel vom Stapel gelaufen und spielte im Seekrieg allerding keine große Rolle. Sie war 1914 im Wettlauf des Wettrüstens vor dem Krieg schon veraltetet. 1916 wurde das Schiff, das bis zu 750 Mann Besatzung hatte, aus dem Kriegsdienst genommen und lag danach in Kiel als Exerzier- und Wohnschiff vor Anker.
In der Heimat wurde 1914 der „Hurra-Patriotismus” mit Siegesmeldungen gepflegt, während auf den hinteren Seiten seitenlange Verlustlisten und Todesanzeigen zu finden waren. Beides spiegelte sich in Gedichten wider, wie sie der „Braunschweiger Allgemeine Anzeiger” am 5. September 1914 veröffentlichte:
Süß ist es und ehrenvoll…
Manch frommer Held mit Freudigkeit
Hat zugesetzt mit Leib und Blute,
Starb sel’gen Tod auf grüner Heid’
Dem Vaterland zugute.
Kein schön’rer Tod ist in der Welt,
Als wer vom Feind erschlagen,
Auf grüner Heid’, im freien Feld
Darf nicht hör’n groß Wehklagen.
Das Braunschweiger Infanterieregiment 92, das gemeinsam mit dem Stab und der 3. Eskadron der Braunschweiger Husaren Nr. 17 sowie dem 2. Hannoverschen Infanterieregiment Nr. 77 (Standort Celle) die 40. Infanterie-Brigade bildete, erhielt nach verlustreichen Kämpfen an der Westfront im April 1915 den Marschbefehl an die Ostfront, um die verbündeten österreichischen Truppen zu unterstützen.
Wird fortgesetzt