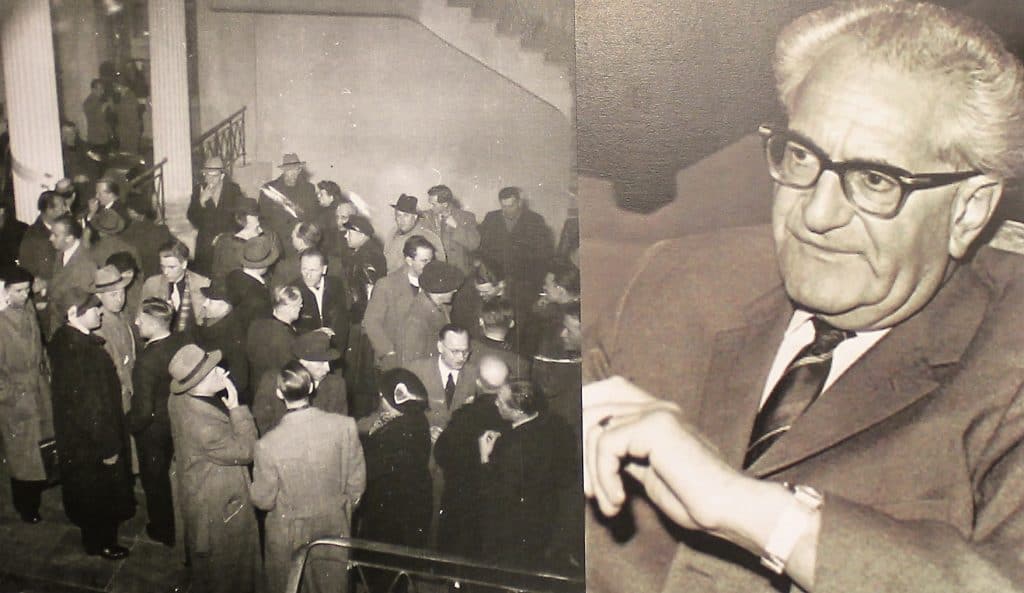Geschichte(n) von nebenan, Folge 4: Die Elektrifizierung der Dörfer rund um Braunschweig vor 100 Jahren.
Mit der Inbetriebnahme des Gleichstromwerk in der Wilhelmstraße begann im Jahr 1900 die Versorgung privater und gewerblicher Kunden in Braunschweig mit elektrischem Strom. Bis dieser „Luxus“ jedoch auch in den Dörfern um die Stadt herum ankommen sollte, vergingen weitere Jahrzehnte. Einzelne Stadtteile wie Mascherode verzeichneten die vollständige Elektrifizierung um 1925, wie ein Protokoll des dortigen Gemeindevorstehers belegt. Generell war die Elektrifizierung in Deutschland ein Prozess, der in den 1880er Jahren begann und sich durch den Aufbau von Netzen sowie die Einführung von Strom in Haushalten und für den öffentlichen Nahverkehr fortsetzte. Bereits 1897 fuhr beispielsweise die erste elektrische Straßenbahn vom Augustplatz in Braunschweig bis nach Wolfenbüttel zum Landratsamt.
Braunkohle in Helmstedt
Nach der Stromversorgung für die Stadt machten sich die Verantwortlichen in den Braunschweig umgebenden Dörfern Gedanken über die zukünftige Versorgung ihrer Bürger und Betriebe mit Elektrizität. Der Anstoß zur Realisierung kam von der Firma PreußenElektra (Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) aus Berlin. Sie hatte die Braunschweigischen Kohlenbergwerke und die Überlandzentrale Helmstedt (ÜLZ) gegründet, weil sich in Helmstedts Süden große Braunkohlereserven befanden, die unmittelbar zur Stromherstellung geeignet waren. Um die erstellten Kraftwerke effizient nutzen zu können, sollten neue Absatzmärkte erschlossen werden. Deswegen ergriff die Geschäftsführung die Initiative, die Dörfer im Herzogtum Braunschweig von den Vorteilen der Elektrifizierung zu überzeugen.
Schließlich bat die Herzogliche Kreisdirektion Mascherodes Gemeindevorsteher August Bötel, die Potenziale für einen Anschluss des Ortes auszuloten. Dazu wurde ein Fragebogen an alle Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe von ihm ausgegeben und dann ermittelt, dass 410 Einwohner zu zählen und die Ortschaft als „wohlhabend” einzuschätzen war. Es gab damals 26 landwirtschaftliche Betriebe, davon 22 mit Pferdehaltung. Neben den Angaben über Feldgrößen und angebauten Früchten listete August Bötel auch die „handwerksmäßigen Betriebe” auf. Das waren Bäcker, Stellmacher, Tischler und Zimmermann, Schmied sowie Bauunternehmer.
Beschluss der Herzoglichen Kreisdirektion
Das Anschlussprozedere ging weiter, als 1913 der Gemeinderat Mascherode von der Herzoglichen Kreisdirektion einberufen wurde. Man fasste dabei einen ordentlichen Beschluss zur gewünschten Elektrifizierung, der vom Herzoglichen Staatsministerium gebilligt wurde. Gleichzeitig hatten die Herzoglichen Kreiskommunalverbände Riddaghausen / Vechelde (dazu zählte Mascherode) und Wolfenbüttel das Überlandwerk Braunschweig GmbH (ÜLW BS) gegründet. Es bündelte die von 93 Landgemeinden unterschriebenen Lieferverträge und schloss mit der ÜLZ Helmstedt, der Tochter der PreußenElektra, für das erste Geschäftsjahr 1913/14 einen Strombezugsvertrag.
Schließlich erhielt die ÜLZ den Auftrag, eine 50 000-Volt-Leitung vom Kraftwerk bei der Grube „Emma” im Kreis Helmstedt bis zur Übergabestation „Moritzburg” (am Möncheweg zwischen der Lindenbergsiedlung und der Südstadt) zu installieren. Von dort verlegte das Überlandwerk Braunschweig Mittelspannungs-Versorgungsleitungen (15/20 KV) als Freilandleitungen in die angeschlossenen Dörfer. Bei genügender Ortsgröße errichtete man dort Transformatorenhäuser zur Umspannung in 220/380 Volt.

Erstes Transformatorenhaus 1914
In Mascherode entstand 1914 das Transformatorenhaus an der Ecke Möncheweg / Alte Kirchstraße / Hinter den Hainen. Später kamen noch die Transformatorenhäuser Schmiedeweg und Jägersruh hinzu. Im zweiten Geschäftsjahr verlangsamte sich der Bau von Leitungen und Betriebsanlagen. Durch kriegsbedingte Beschlagnahme von Kupfer gab es teilweise sogar Baustopps bei einhergehender Suche nach Ersatzmaterialien (verzinktes Eisenseil wurde benutzt, hatte allerdings eine siebenmal kleinere Leitfähigkeit als Kupfer!).
Im Geschäftsjahr 1915/16 des ÜLW BS wird für Mascherode festgehalten, dass es bei 415 Einwohnern bereits 40 Abnehmer gab. 641 Glühlampen und elf Motoren wurden mit Strom versorgt. Das waren 1,5 Lampen pro Einwohner bei einem Durchschnitt aller Gemeinden im Amt Riddagshausen / Vechelde von 0,87. Mascherode wies also bedeutende Anschlusswerte auf, einschließlich einer durchgehenden Straßenbeleuchtung.
Trotz des Ersten Weltkrieges und der unsicheren politischen Verhältnisse Anfang der 1920er-Jahre setzte sich die verstärkte Nutzung der Elektrizität im Land Braunschweig durch. Es wirkten sich offensichtlich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von 1928 an nicht negativ aus. Der Siegeszug der Elektrifizierung ließ sich nicht aufhalten, weil sich das Leben der Menschen durch sie sehr viel komfortabler gestalten ließ.
Henning Habekost ist Stadtteilheimatpfleger für Mascherode.