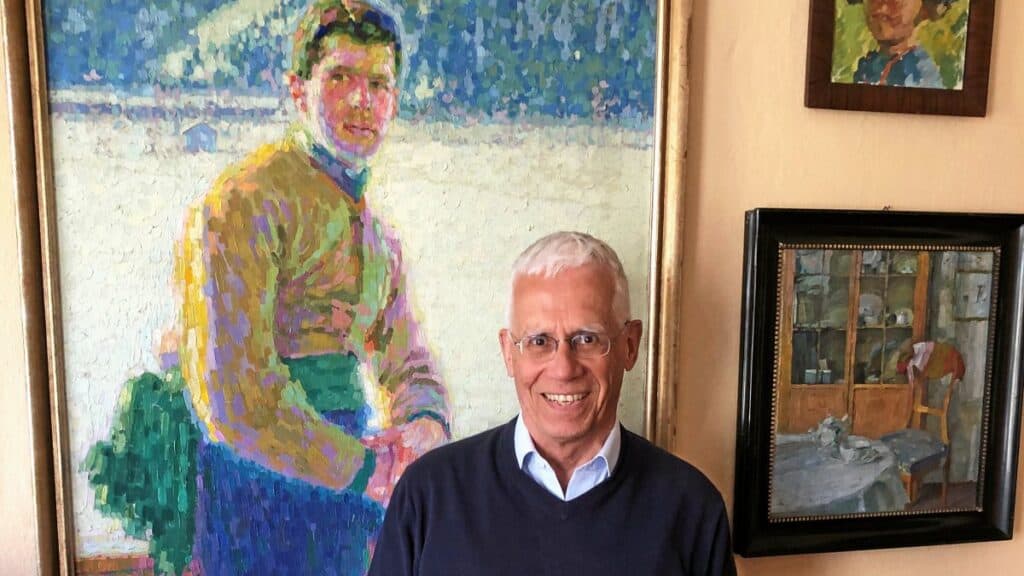Im Gespräch erzählt der scheidende Direktor des Herzog-Anton-Ulrich-Museums von seinen Erwerbungen und internationalen Verknüpfungen.
Mit der Ausstellung „Kunst setzt Zeichen“ verabschiedet sich Professor Jochen Luckhardt aus seinem Amt als Direktor des Herzog-Anton-Ulrich-Museums in Braunschweig. 1990 hat er es übernommen, im Februar 2019 geht er mit 66 Jahren offiziell in den Ruhestand. Seine Abschiedsschau vereint die Neuerwerbungen seiner Amtszeit. Zum Gespräch traf ihn Kulturredakteur Andreas Berger in seinem Büro im Anbau des Museums.
 Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.10.2018. (Bezahl-Artikel)
Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.10.2018. (Bezahl-Artikel)
Nun waren Sie so lange Museumschef. Woher kam die Liebe zur Kunst?
Ich komme aus einem sehr geschichtsträchtigen Flecken, der kleinen Stadt Gevelsberg zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Schon als Kind wurde mir die Geschichte von der Mordtat am Reichsverweser und Kölner Erzbischof Engelbert erzählt, ausgeübt 1225 von seinem Neffen Graf von Isenberg in einem Hohlweg am Hang des Gevelsbergs. Zur Sühne wurde dort ein Zisterzienserinnenkloster gebaut mit einer Holzstatue Engelberts, die es heute noch in einem westfälischen Museum gibt. Über die schrieb ich dann als Student meinen ersten Aufsatz. Und es ist schön, wie sich der Kreis im Kulturhauptstadtjahr des Ruhrgebiets 2010 wieder schloss, als ich den entsprechenden Katalogbeitrag im Ausstellungskatalog „Das Ruhrgebiet im Mittelalter“ schreiben durfte.
Geschichte hat mich immer interessiert, ansonsten war ich gar nicht so gut in der Schule. Und die Kunst fand ich auch immer dann besonders spannend, wenn sie Geschichte(n) erzählt. Die Geschichten, die hinter einem Kunstobjekt stecken, waren für mich das Faszinosum. Darum habe ich mein Büchlein zur Wiedereröffnung des Museums auch „50 Kunstgeschichten aus dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum“ genannt. Die notwendige Auswahl ist sehr persönlich, und mancher hat sich sicher gewundert, warum etwa unser berühmter Vermeer nicht dabei ist. Es sind meine 50 Lieblingsobjekte, eben weil sie Geschichten erzählen.
Solchen Geschichten muss man aber erstmal auf die Schliche kommen. Sie haben sich neben der Museumsleitung immer weiter als Forscher betätigt und haben auch einen Lehrauftrag als Honorarprofessor an der Universität Halle.
Ich habe natürlich auch zu Hause meinen Schreibtisch und meine Bibliothek. Ich sage meinen Studenten immer, Kunstgeschichte ist wie ein Krimi. Man muss herausbekommen, wer hat’s getan, wann, wo, für wen? Da braucht es Spürsinn und Geduld. Nehmen Sie Ludger tom Ring den Jüngeren, der 1522 in Münster geboren wurde und 1584 in Braunschweig starb. Ich kannte ihn schon aus Münster, wo ich studiert und promoviert habe, und in der Braunschweiger Sammlung haben wir seine Porträts des Goldschmieds Reiners und seiner Frau. In meiner Amtszeit konnten wir dank der Unterstützung von Stiftungen sein Selbstbildnis von 1547 erwerben.
Ich betone bei jeder Führung, dass Ludger tom Ring einer der bedeutendsten europäischen Maler ist. Seit 1569 lebte er in Braunschweig. Das „Küchenstück mit der Hochzeit zu Kanaa“, das als Reproduktion noch in Originalgröße hinter meinem Schreibtisch hängt, ist vermutlich im Flakbunker in Berlin, wohin es ausgelagert war, 1945 verbrannt. Es zeigt vorne die reich gedeckten Tische, durch eine Raumöffnung blickt man hinüber zur Hochzeitstafel, wo Christus Wasser in Wein verwandelt. Die Farbreproduktion wurde möglich, weil nach der Wende in DDR-Altbeständen vier Fotoglasplatten des Gemäldes gefunden wurden, welch ein Glück.
Es ist auf 1562 datiert, aber wo befand sich der Maler damals? Nicht mehr in Münster, aber auch noch nicht in Braunschweig. Ein Porträt an der Wand im Gemälde konnte ich identifizieren als Richard Clough, den Vertreter der englischen Krone in Antwerpen. Und beim Blättern in den Mitgliederlisten der Lukasgilde zu Antwerpen, die wir hier in unserer Bibliothek haben, habe ich dann Ludgers Namen gefunden. Dieses große Küchenstück mit Stillleben entstand also in Antwerpen, es ist damit die Keimzelle der dort einsetzenden Stilllebenmalerei, nicht eine Folge davon. Der spätere Braunschweiger Bürger gehört also in die ersten Reihen der Kunstgeschichte.
Wie kam denn nach dem Studium Braunschweig in den Blick? Wann waren Sie zum ersten Mal im Anton-Ulrich-Museum?
Braunschweig war mir schon deshalb ein Begriff, weil meine Frau aus Goslar kommt. Wir waren also immer mal in der Region, und 1975 war ich von Goslar aus zum ersten Mal zu einer Ausstellung über die deutsche Kunst des Barock ins Anton-Ulrich-Museum gefahren. Im Rückblick fügen sich einem die Lebensstationen ja oft so zusammen, als ob das alles so seinen Sinn gehabt hätte. Mein Gebiet waren Skulpturen und Malerei des Mittelalters und Kunst des Barock, dort aber vor allem die Architektur, ich habe ja dann über die Dominikanerkirche in Münster promoviert, und da deren Baumeister Vorbilder in Rom und Paris hatte, bekam ich Stipendien dorthin.
Mit 25 war ich promoviert, das ging also sehr schnell. Und dann konnte ich auch durch den Leiter des Schnütgen-Museums in Köln, der Honorarprofessor in Münster war, schon an Katalogen mitarbeiten, Aufsätze schreiben, wurde früh wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster. Wir erfassten die Ortsansichten in ganz Westfalen, acht Ansichten pro Tag musste ich schaffen, habe unter anderem alle Schlösser im Kreis Höxter bereist. Und schon bald wurde ich Abteilungsleiter für Malerei am Westfälischen Landesmuseum. Damit hatte ich dann mit 37 die nötigen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen für eine Museumsleitung beisammen. Ich finde, man muss jung an ein Direktorenamt gehen, um etwas bewirken zu können.
Was hat Sie am Anton-Ulrich-Museum und an Braunschweig besonders gereizt?
Da ist einerseits die ungeheure Dichte an Museen, Bibliotheken und Archiven in der Region, die man in vielen Großstädten so nicht hat. Ich glaube, das erkennen auch die Braunschweiger oft gar nicht so, dazu muss man von außen gucken. Und das Herzog-Anton-Ulrich-Museum überzeugte mich durch das Potenzial seiner Sammlung. Und die Entwicklungsmöglichkeiten. Ich wollte ja auch inhaltlich arbeiten, nicht nur verwalten. Und da finde ich es bis heute großartig, wie breit das Museum aufgestellt ist. Die Bestände reichen von der Antike bis heute. Es ist ein Universalmuseum, das alle Gattungen und Epochen auf internationalem Niveau präsentiert.
Da konnte man auch Entdeckungen im eigenen Hause machen, wenn man etwa die Werke der Angewandten Kunst nimmt, die vielfach erstmal restauriert werden mussten. Heutige Prachtstücke der Ostasiatika-Sammlung haben wir im Keller zerrissen aufgehängt gefunden. Wir haben die Teilbereiche durch Forschungen neu erschlossen und in Bestandskatalogen präsentiert. Mir waren alle Themen der Kunst mit inhaltlicher Breite wichtig.
Epochen spiegeln nicht nur Stil, sondern sie vermitteln auch ein Lebensgefühl, die Lebensumstände einer Zeit. Und das muss man miterzählen. Wir erklären, wozu die Kunst jeweils da war, etwa zur Repräsentation. Wir präsentieren unsere Gemälde nicht nur nach Schulen, sondern auch nach Themen wie Familie, konfessioneller Wandel und Selbstdarstellung.
1990 wurden Sie Direktor des Anton-Ulrich-Museums. Ist es nicht herrlich, wenn man dann ein Haus renovieren und nochmal ganz neu konzipieren und einräumen kann, wie Sie es im restaurierten und erweiterten Gebäude 2016 konnten?
Ich bin den Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski und Christian Wulff, die das Projekt durch- und umsetzten, sehr dankbar. Das Gebäude war aber auch vollständig marode. Wir mussten 1992 und 96 zum Beispiel die undichten Glasdächer ersetzen, weil die Hausmeister nach Platzregen die Pfützen auf dem Dachboden aufwischen mussten. Der Brandschutz war völlig ungenügend. Dass wir die Verwaltung, Kupferstichkabinett, Bibliothek, Depots und Werkstätten auslagern konnten in einen Neubau, ist ein traumhafter Erfolg. Die Fassadenprobleme werden jetzt noch gelöst, aber wir sind von der Funktionalität innen sehr angetan.
Dadurch konnten wir das Haupthaus in seine originale Struktur zurückversetzen und haben jetzt noch 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche mehr. Wir können jetzt ja 4000 Objekte auf 4000 Quadratmetern präsentieren.
Wo sehen Sie Lücken, wo sind Wünsche offen geblieben? Viele Besucher finden es ja schade, dass im 19. und 20. Jahrhundert die Gemäldegalerie nicht mehr fortgeführt wurde. Gibt es überhaupt einen Ankaufsetat?
Die Sammlung für Gemälde und Skulpturen wurde im 19. Jahrhundert für geschlossen erachtet, das ist natürlich bedauerlich. In der Grafik allerdings sind alle wichtigen Künstler auch der Moderne vertreten, bis hin zu Beckmann, Beuys und Warhol. Heute können sich öffentliche Sammlungen Gemäldenachkäufe aus der klassischen Moderne auf breiter Basis nicht mehr leisten. Ankäufe aus eigenen Mitteln sind sowieso unmöglich, da kann man nur ausgeben, was man im eigenen Haushalt womöglich erwirtschaftet hat.
Wir sind da völlig auf Sponsoren und Stiftungen angewiesen, und zum Glück konnte ich immer wieder Institutionen wie die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Stiftung Niedersachsen, die Fritz-Behrens-Stiftung, die Richard-Borek-Stiftung oder das Bundesministerium für Kultur und Medien gewinnen, uns Geld zu geben oder Werke für uns zu erwerben. Sie bleiben dann in deren (Teil-)Besitz und stehen uns als Dauerleihgabe zur Verfügung. Seit 1990 habe ich Drittmittel von insgesamt etwa 23 Millionen Euro zusammengebracht für Ausstellungseinrichtungen, Forschung sowie Neuerwerbungen. Auch der Verein der Freunde des Museums hilft dabei.
4410 Werke haben wir während meiner Amtszeit bisher zusätzlich ins Haus geholt. Wir zeigen eine Auswahl in meiner Abschiedsausstellung „Kunst setzt Zeichen. Neuerwerbungen aus dem alten Europa“.
Wie sicher sind Dauerleihgaben? Was ist, wenn der Stifter sie wiederhaben will?
Bei extra für das Museum auf Antrag erworbenen Werken kommt das so gut wie nie vor. Für die Stifter sind das oft Vermögensanlagen, auf die sie verweisen können, und bei uns hängen sie gut und sicher. Außerdem werden Werke oft von mehreren Stiftern gemeinsam gekauft, da kann man dann schlecht den Anspruch auf ein Teilstück weiterverkaufen. Im Übrigen sind solche Leihgaben unter Umständen sicherer als die Werke in öffentlicher Hand, da hat es ja besonders in verschiedenen Ruhrgebietsstädten auch schon Verkaufsabsichten und Verkäufe gegeben, um städtische Haushalte zu sanieren.
Was hat Sie enttäuscht?
Dass sich das Welfenhaus, und damit meine ich nicht den jetzigen jungen Welfenchef, sich bei seinen früheren Veräußerungen von nationalem Kulturgut nicht erstmal mit uns Museumsleuten aus der Region verständigt hat. Das Welfenhaus hat es anscheinend nicht interessiert, dass möglichst viele Werke in der Region bleiben. Im Gegensatz hierzu gibt es Adelshäuser in Deutschland, die ihre Kunstschätze als Stiftung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, etwa der Landgraf von Hessen. Die Welfen haben 1866, als sie in Hannover den Preußen weichen mussten, alles Mögliche mitgenommen, wie den Reliquienschatz aus Braunschweig oder das Evangeliar Heinrichs des Löwen. Das Land Niedersachsen und verschiedene Stiftungen haben dann zum Beispiel 2009 drei von 15 der Celler Pokale aus altem Welfenbesitz bei der Versteigerung der Sammlung von Yves Saint-Laurent wieder zurückgekauft.
Was würden Sie sich in Zukunft für das Anton-Ulrich-Museum und die Region wünschen?
Natürlich viele interessierte Besucher. Im Herzog-Anton-Ulrich-Museum kommen 50 Prozent der Besucher aus der Region und 50 Prozent aus dem Rest der Welt. Das zeigt, dass die Wertschätzung unseres „Louvres des Nordens“ überregional groß ist, vor Ort hat sie spätestens seit der Neueröffnung zugenommen. Die Besucherzahl ist insgesamt gestiegen, aber sie könnte gemessen an der Qualität des Hauses höher sein. Daran zeigt sich, dass Braunschweig kein Tourismusziel wie München oder Hamburg ist. Und da würde ich mir manchmal mehr Werbung durch die Stadt oder aus der Region heraus wünschen. Die kulturelle Dichte und Qualität ist hier außerordentlich hoch, das müsste noch besser vermarktet werden. Und das müsste auch vom Land noch stärker unterstützt werden. Die Kulturträger der Region müssten sich dazu aber auch stärker zusammentun und Wirkungsziele und Prioritäten festhalten. Da verzettelt sich manches in den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Bei der Kulturhauptstadtbewerbung hat das sehr gut geklappt, diesen Schwung, diesen Gemeinschaftsgeist bräuchten wir wieder.
Auch große Sonderausstellungen sind Besucherattraktionen.
Das läuft im Anton-Ulrich-Museum jetzt wieder an. Seit wir im neuen Haus sind, funktioniert das Netzwerk wieder stärker. Werke von uns hängen in diesen Monaten im Getty Museum Los Angeles, im Metropolitan Museum New York, in der Hamburger Kunsthalle und im Rijksmuseum Amsterdam. Das ist die Grundlage für internationalen Austausch. Wir bekommen demnächst aus Amsterdam drei große Werke für unsere Schau rund um Pieter Brueghels „Kreuztragung Christi“. Das wird weitergehen, nach derzeit 264 Jahren hört das Museum, das mit dem British Museum zu den ersten öffentlich zugänglichen Museen Europas gehört, nicht einfach auf…
 Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.10.2018 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article215653285/Jedes-Kunstobjekt-ein-Kriminalfall.html (Bezahl-Artikel)
Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.10.2018 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article215653285/Jedes-Kunstobjekt-ein-Kriminalfall.html (Bezahl-Artikel)