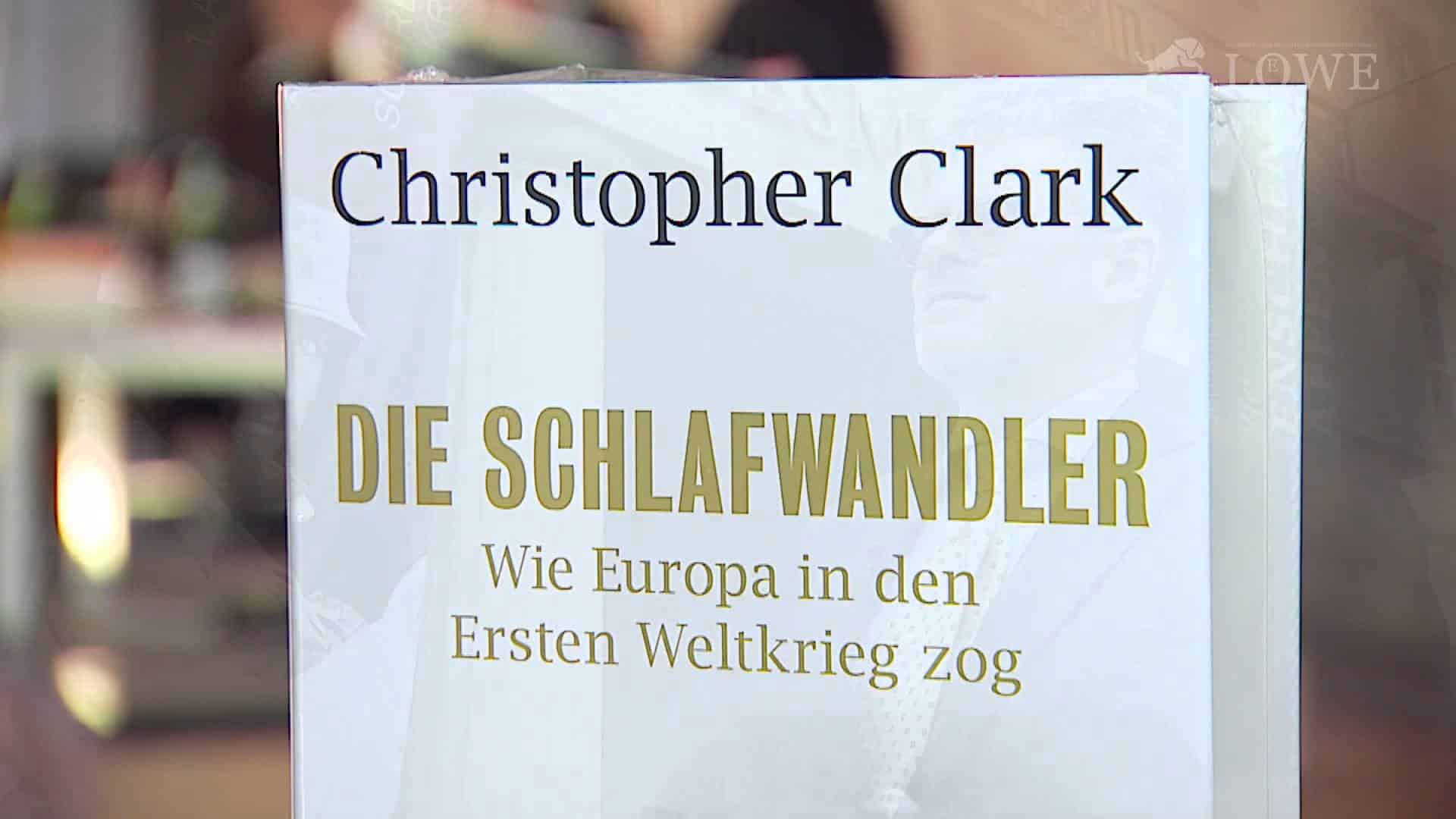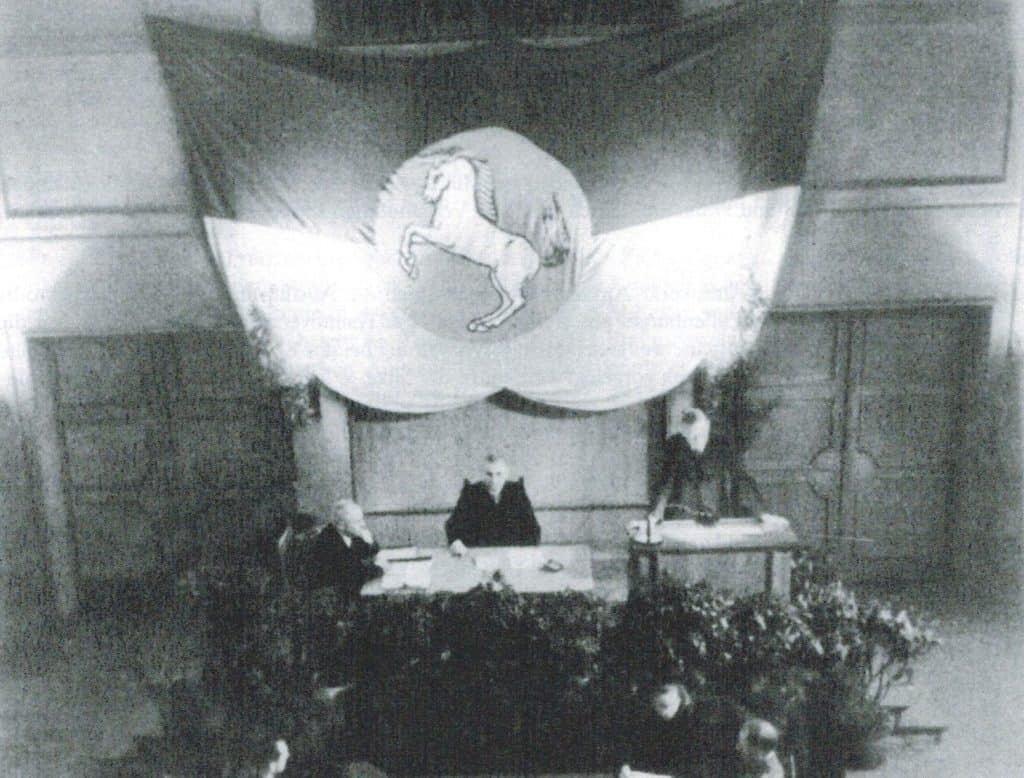Ein Gespräch mit dem australischen Historiker Christopher Clark am Rande des Besuchs der Ausstellung „1914 – Schrecklich kriegerische Zeiten“ im Braunschweigischen Landesmuseum.
Herr Professor Clark, Ihr Buch „Die Schlafwandler“ hat hohe Wellen geschlagen, und es ist ein Bestseller. Als Sie mit der Recherche begannen, haben Sie sich vorstellen können, dass das Thema tatsächlich so viele Menschen noch 100 Jahre nach den Ereignissen in seinen Bann ziehen könnte?
Überhaupt nicht. Niemand, niemand stellt sich so etwas vor. Das kann man nicht planen. Der Verlag hat auch nicht damit gerechnet. Es gab anfangs keine Extra-Auflagen. Es herrschte die Meinung, der Erste Weltkrieg wäre in Deutschland weitgehend vergessen, durch das Trauma des Zweiten Weltkriegs verdrängt und verschüttet worden. Also insofern war der Erfolg eine große Überraschung.
Sie schreiben die Verantwortlichkeiten für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs neu. Das polarisiert und ist interessant. Sie nehmen Deutschland einen Teil der Schuld. Macht diese These den Erfolg aus?
Das ist sicherlich mit ein Aspekt. Wobei ich überhaupt nicht darauf hinaus wollte, den Deutschen einen Freispruch zu erteilen. Ich finde nach wie vor, dass es nichts gibt in der deutschen Außenpolitik von 1914, auf das man stolz zurückblicken könnte. Darum ging es überhaupt nicht. Ich wollte das Ganze, das Internationale, das Vernetzte dieses Ereignisses hervorheben. Es ging eben nicht nur um die Handlungen eines Staates, sondern um die Interaktionen zwischen vielen Staaten.
Wäre 1914 mit etwas Besonnenheit agiert worden, wäre dann der Welt das große Leid des 20. Jahrhundert erspart geblieben?
Meines Erachtens ist dieser Erste Weltkrieg der schlechteste mögliche Ausgangspunkt für die Moderne des 20. Jahrhunderts. Das ist, wie schon Fritz Stern gesagt hat, das Desaster aus dem die ganzen Desaster des 20. Jahrhunderts herausgesprungen sind. Ohne diesen Krieg kann man sich den wirklich katastrophalen Kurs dieses Jahrhunderts kaum vorstellen. Stalinismus, Nationalsozialsozialismus, Holocaust, Faschismus in Italien – das alles wäre ohne diesen Krieg schwer vorzustellen und wäre schwer zu erklären.
Sie erfahren in Deutschland durchaus Kritik für ihr Relativieren der deutschen Kriegsschuld. Wie steht es mit der Kritik in Frankreich, in Russland, in Nationen, die Sie stärker belasten als das die bisherige Geschichtsschreibung tat.
Das Interessante ist, dass man eigentlich nur in Deutschland sehr auf die Schuldfrage fokussiert ist. Das ist in Deutschland immer noch ein Politikum. Frankreich geht viel souveräner mit dieser Frage nach Schuld um. Das ist in der französischen Öffentlichkeit überhaupt nicht angeeckt, dass die Franzosen sozusagen stärker ins Bild gerückt werden. Man nimmt das dort gerne hin und sieht das als die europäische Betrachtung eines europäischen Ereignisses. Das ist natürlich in Deutschland ganz anders. Da fokussiert man noch stark auf die Schuldfrage, das zeigen die Reaktionen auf das Buch und die daraus resultierende Debatte.
Mindestens in den deutschen Geschichtsbüchern ist die Schuldfrage relativ klar definiert. Müssen wir sie umschreiben?
Ich finde, man muss nicht unbedingt abrücken von dem Bild, das Fritz Fischer schon in den 60er und 70er Jahren gezeichnet hat. Er hat ein Psychogramm der deutschen Eliten gezeichnet, das auch heute noch beunruhigend ist. Sehr viel an Bellizismus, Paranoia, Angst um die Zukunft, aber auch Aggressivität, der Wunsch oder der Wille nach einem präventiven Krieg – das alles besteht doch noch. Allerdings muss die Ereignisse fester im europäischen Kontext einrahmen und sehen, dass dieser große Krieg – im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg übrigens – in einer sehr komplexen Welt durch Interaktionen zwischen verschiedenen Großmächten, die alle bereit waren den großen Krieg zu riskieren, um ihre eigenen Interessen zu realisieren, seine Ursache hatte. Die Komplexität dieser Kriegsentstehung gilt es nun besser in unser Verständnis dieser Vergangenheit einzuarbeiten.