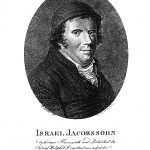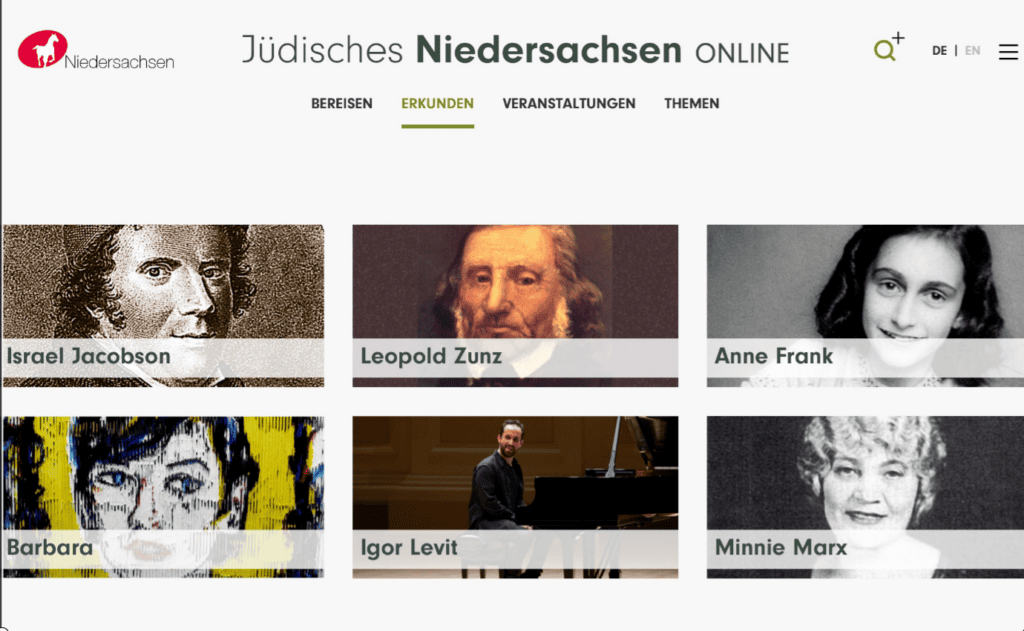Rund 30 Institutionen und Privatpersonen kooperieren im Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte (IJN).
„Das Land Braunschweig war seit der Aufklärung eine Musterregion deutsch-jüdischer Kultur“, erklärt Prof. Alexander von Kienlin, Leiter der Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa und des Instituts für Baugeschichte der Technischen Universität Braunschweig. Um das in vielen Aspekten noch unbekannte Thema fundiert aufzuarbeiten, wurde im April 2016 unter Beteiligung der TU Braunschweig und der Allianz für die Region das Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte (IJN) ins Leben gerufen. Rund 30 Netzwerkpartner aus den Bereichen Forschung, Sammlung, Vermittlung, Bildung, Politik und Verwaltung werden mit Hilfe von Forschungsprojekten die Erinnerungen an das aufgeklärte, liberale deutsche Judentum im Braunschweiger Land wachhalten.
Der prominenteste Kooperationspartner ist das Leo Baeck Institut in New York. Das Institut mit Weltruhm sammelt seit 1955 in den drei Teilinstituten – in den Zentren jüdischer Emigration – in Jerusalem, London und New York City Lebenserinnerungen, Akten und Dokumente über die Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums. Viele mittlerweile digitalisierte Unterlagen exilierter Juden lagern beim Leo Baeck Institut, darunter auch Nachlässe von Emigranten aus Braunschweig, Seesen, Wolfenbüttel und anderen Orten unserer Region.
Mit dem renommierten amerikanischen Forschungsinstitut verabredete das IJN gleich beim Start zahlreiche Projekte. Zwei Ausstellungen zum Thema sollen in Deutschland und den USA erarbeitet und gezeigt werden. „Während das Forschungsthema in unseren Landen häufig ein unbekanntes Phänomen ist, bewerten die Juden in den USA unsere Region schon lange als einen der Hotspots des weltweiten Reformjudentums“, betont Prof. Alexander von Kienlin. Ziel sei der Aufbau eines „Wissensspeichers“ zu der Thematik.
Welchen Stellenwert das schon jetzt national und international vielbeachtete Projekt besitzt, beweist der Besuch von Dr. Felix Klein, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Antisemitismusfragen, in der Region. Nur wenige Tage nach der IJN-Gründung im April dieses Jahres besichtigte der Botschafter des Auswärtigen Amtes die Erinnerungsstätte für die Zwangsarbeiter auf dem Gelände des Volkswagen Werkes in Wolfsburg. Im Anschluss besuchte Dr. Klein, der die diplomatische Abstimmung mit nationalen und internationalen jüdischen Organisationen begleiten wird, das Lessinghaus und die berühmte Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Historische Orte: Dort trafen sich der jüdische Aufklärer und Philosoph Moses Mendelssohn und der in Wolfenbüttel als Bibliothekar arbeitende Gotthold Ephraim Lessing. In seinem Arbeitszimmer im Lessinghaus schuf Lessing das Werk „Nathan der Weise“, ein Schlüsseldokument aufgeklärter Toleranz.
Woher stammt der Name für das Netzwerk? Einer der führenden Köpfe der jüdischen Reformbewegung war der Bankier des Braunschweiger Herzogs, Israel Jacobson. Er gründete in Seesen die Jacobsonschule, eine jüdische Freischule, die auch christliche Kinder besuchen durften. In der von Jacobson erbauten Synagoge wurde die Liturgie auch auf Deutsch gesprochen, darüber hinaus existierte eine Orgel. Jacobsons „Tempel“ gilt als die „Mutter-Synagoge“ aller jüdischen Reformgemeinden. Das Ziel der jüdischen Aufklärung verfolgte auch die in den 1780er Jahren gegründete Wolfenbütteler Samson-Schule, bis sie in der Weltwirtschaftskrise 1929 aufgrund finanzieller Probleme die Pforten schloss. Die ehemaligen jüdisch-christlichen Reformschulen in Wolfenbüttel und Seesen und die Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Synagogen in Braunschweig und Wolfenbüttel sind Symbole jüdischer Integrationsleistung in die nichtjüdische Gesellschaft.
In der Region Braunschweig wurden im Rahmen des Israel Jacobson Netzwerks erste Forschungsprojekte auf den Weg gebracht. Beispiel: Im Stadtarchiv Hornburg liegen große Teile der dortigen ehemaligen jüdischen Gemeinde. Ein wertvoller Schatz, denn die meisten jüdischen Gemeindearchive wurden bei der „Reichspogromnacht“ im November 1938 durch die Nationalsozialisten gezielt vernichtet. Jetzt sollen die Schriften in Zusammenarbeit mit der Hornburger Archivleiterin Dr. Sybille Heise transkribiert werden. Große Teile der Synagogen-Einrichtung kamen bereits 1923 in das damalige „Vaterländische Museum“, das heutige Braunschweigische Landesmuseum. Wie durch ein Wunder überlebte das einmalige Zeugnis jüdischer Religion und Kultur unbeschadet die zwölf Jahre des NS-Terrors.
Am. 6. April 2016 hat sich der Verein Israel Jacobson Netzwerk gegründet, dessen Präsident Prof. Dr. Alexander von Kienlin Leiter der Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur ist. Die Bet Tfila wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und u.a. auch von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sowie einige Male von der Braunschweigischen Stiftung gefördert. Seit 1994 dokumentiert und erforscht die Braunschweiger Forschungsstelle, die aktuell über drei hauptamtliche Projektmitarbeiter verfügt, jüdische Ritualbauten in Niedersachsen und anderen Bundesländern. Sie kooperiert dabei eng mit ihrem Partnerinstitut, dem Center for Jewish Art an der Hebräischen Universität Jerusalem.
Fotos