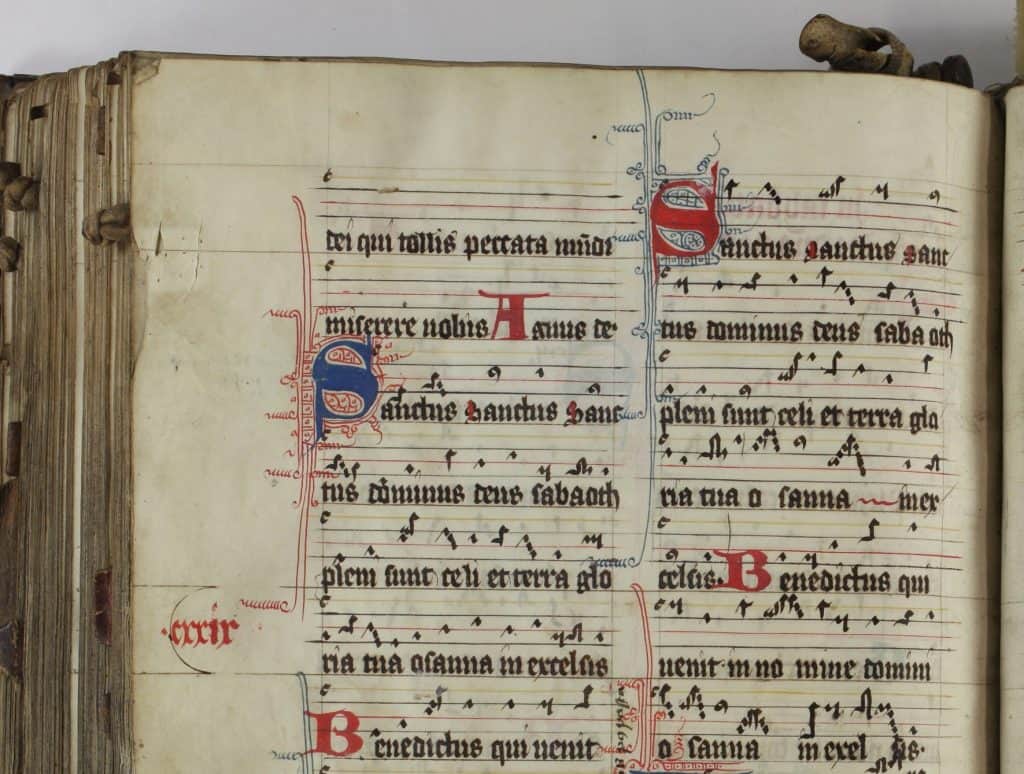Dendrochronologische Untersuchung des Dachwerks über St. Aegidien ergibt Entstehungszeit kurz vor der Reformation.
Braunschweig besitzt eine der größten spätmittelalterlichen Dachkonstruktionen Norddeutschlands. Das gewaltige, 18 Meter hohe Dachwerk der Aegidienkirche stellt eine hölzerne Kathedrale über der steinernen Kirche dar. Die vom Bistum Hildesheim an das TU-Institut für Holzbau und Baukonstruktionen in Auftrag gegebene dendrochronologische Untersuchung (Jahrringchronologie) ergab, dass die Bauhölzer für das große Hallendach zwischen 1512 und 1514 gefällt wurden. Die Hölzer wurden erfahrungsgemäß frisch verbaut. Damit ist die Dachkonstruktion von St. Aegidien älter als 500 Jahre.
Beeindruckendes Beispiel

„Mit diesem Hallendach besitzt Braunschweig ein beeindruckendes Beispiel der Zimmermannskunst des späten Mittelalters mit einer großen Bedeutung für die vorindustrielle Bautechnikgeschichte“, erläuterte Bauhistoriker Elmar Arnhold (gebautes Erbe). Er war neben Professor Mike Sieder und Dr. Elena Perria vom TU-Institut für Holzbau und Baukonstruktionen und Moritz Reinäcker vom TU-Institut für Baugeschichte an der dendrochronologische Untersuchung beteiligt. Mit der Probenauswertung war das Labor für Dendrochronologie und Gefügekunde an der Universität Bamberg betraut.
Die Verzimmerung des einheitlichen Großdachs von St. Aegidien erfolgte somit mehr als 40 Jahre nach der Schlussweihe. Möglicherweise existierten bis dahin ältere Dachkonstruktionen oder auch Provisorien. Erneuerungen des Dachs wurden im 18. Jahrhundert und nach dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen, weil ein Bombentreffer einen Teil der Dachkonstruktion beschädigt hatte. Das wesentlich kleinere Chordach stammt im Ursprung aus den Jahren 1637 bis 1639 und wurde im 18. Jahrhundert durch Einbau einer Hängekonstruktion verändert.
39 einheitliche Sparrenachsen
Insgesamt handelt es sich um eine der größten und bedeutendsten Konstruktionen dieser Art in Norddeutschland. Die Dachkonstruktion ist vom Westgiebel bis zum Choransatz mit 39 Sparrenachsen einheitlich und weist somit auf eine Errichtung in einer einzigen Bauperiode hin. Es handelt sich um den spätmittelalterlichen Konstruktionstyp eines „Aufgeständerten Dachwerks“, bei dem das Grundgerüst aus gewaltigen Ständerreihen mit Balkenlage besteht, an denen die Seitendächer anlehnen und der obere Teil der Dachkonstruktion aufgesetzt ist.

Die gotische Aegidienkirche wurde nach einem Stadtbrand, der den romanischen Vorgängerbau des 1115 gegründeten Aegidienklosters zerstörte, im Jahr 1278 mit dem Chor im Osten neu begonnen. Dieser ist in vereinfachter Weise nach den großen Vorbildern aus der französischen Kathedralgotik entworfen und zeigt sich als Basilika mit hohem Hauptschiff und niedrigem Seitenumgang. Auf den Chor folgt das Querhaus mit seiner Schaufassade zum Aegidienmarkt.
Baugeschichte geklärt
An Stelle eines Weiterbaus der Basilika nach Westen folgte um 1300 ein Planwechsel: Das Langhaus wurde im frühen 14. Jahrhundert als Hallenkirche mit drei gleich hohen Schiffen weitergeführt. Dies geschah in zwei Schritten mit einer Bauunterbrechung von fast hundert Jahren: Das Kirchenschiff wurde erst 1478 geweiht, die Westtürme indessen nie fertiggestellt. Über der Hallenkirche erhebt sich das riesige Dachwerk, dessen Baugeschichte nun weitgehend anhand der Bauaufnahme und der dendrochronologischen Untersuchung geklärt werden konnte.
Fakten
Das Romanische Aegidienkloster
Am 1. September 1115 gründete die brunonische Markgräfin Gertrud die Jüngere im Süden der heutigen Innenstadt Braunschweigs ein Benediktinerkloster zu Ehren der Muttergottes Maria. Anwesend waren ihr Schwiegersohn, der spätere Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg, der Halberstädter Bischof Reinhard, ein römischer Legat und weitere hochgestellte Geistliche. Schon im 12. Jahrhundert avancierte der Heilige Aegidius zum Hauptpatron des Klosters, nach 1200 kam der Braunschweiger Stadtheilige St. Auctor hinzu. Die Klosteranlage entstand auf dem Köpfeberg, der höchsten Erhebung über die Okerniederung in weitem Umkreis. Das Areal und seine Umgebung waren zu Beginn des 12. Jahrhunderts noch unbesiedelt. Die ersten Gebäude des neu gegründeten Klosters sind als provisorische Fachwerkbauten zu denken. Die romanische Klosterkirche aus der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde nach dem großen Stadtbrand von 1278 vollständig beseitigt und durch den heute noch existierenden Sakralbau ersetzt. (aus Mittelalterliche Metropole Braunschweig. Architektur und Stadtbaukunst vom 11. bis 15 Jahrhundert von Elmar Arnhold).

Mehr unter: www.der-loewe.info/leser-werden-zu-braunschweig-fans