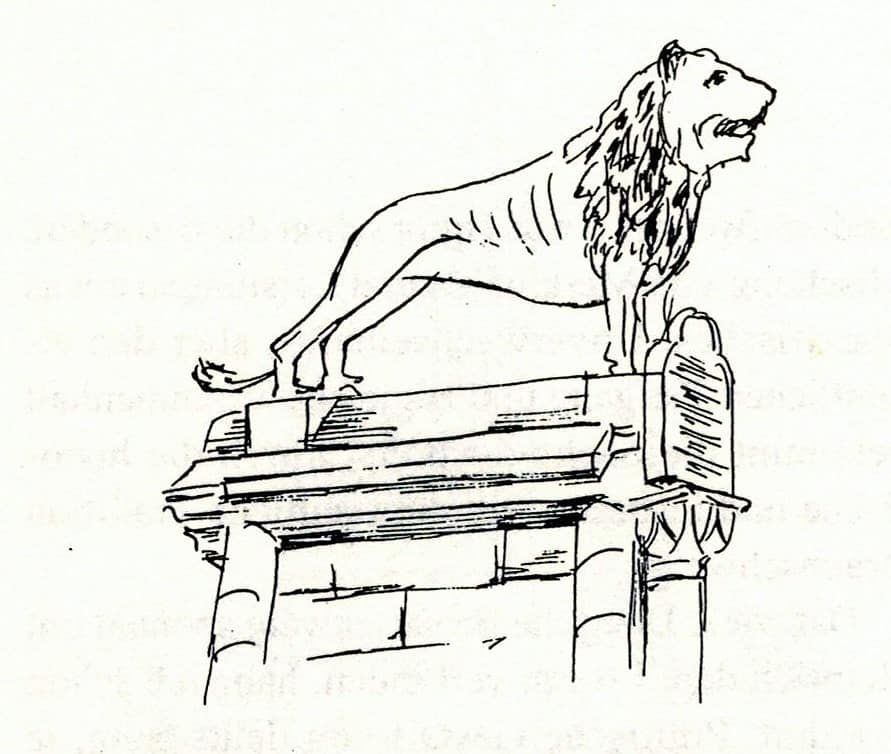Professor Dr. Werner Knopp beleuchtete in einem seiner Werke die Jahrhunderte alte Konkurrenz zwischen Braunschweig und Hannover.
Jedes Mal, wenn ein Derby zwischen den Fußball-Mannschaften von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ansteht, kocht die Rivalität zwischen den beiden größten Städten Niedersachsens hoch. Viele meinen, dass das Konkurrenzdenken von der Bundesliga-Gründung herrührt, als Eintracht mit dem legendären Dr. Kurt Hopert an der Spitze 96 vorgezogen und eines von 16 Gründungsmitgliedern wurde. Aber das stimmt natürlich nicht und wäre eine viel zu einfache Erklärung für dieses tief verwurzelte Phänomen. Auf den Grund des seit Jahrhunderten angespannten Verhältnisses zwischen Braunschweig und Hannover ging Prof. Dr. Werner Knopp in seinen „Anmerkungen über das Braunschweigische und Hannöversche“ ein.
Die immerwährende Rivalität zwischen Braunschweig und Hannover beschreibt ein überliefertes Ereignis aus dem August des Jahres 1864, von dem Knopp berichtet, recht amüsant: Der französische Gesandte in Hannover, Graf von Reiset, unternahm eine Dienstreise nach Braunschweig, und zwar mit der Eisenbahn: „Er hatte aber vergessen, eine Rückfahrkarte zu lösen, und als er in Braunschweig nach der Audienz beim Herzog, bei dem er auch akkreditiert war, die Fahrkarte nach Hannover lösen und mit hannoverschem Geld bezahlen wollte, wurde ihm höhnisch bedeutet: Dieses Geld nehmen wir hier in Braunschweig nicht! Er musste also nolens volens in eine Bank gehen und seine hannoverschen Banknoten in braunschweigische Staatsbanknoten umwechseln, um die Rückreise antreten zu können.“
Über Jahrhunderte hat sich das Konkurrenzverhältnis zwischen Braunschweig und Hannover entwickelt. Von dem einst so einflussreichem Herzogtum und der früher so bedeutenden Handelsstadt ist aus braunschweigischer Sicht beim Kräftemessen mit dem westlichen Nachbarn nicht viel übrig geblieben. Die Rivalität hat das Bewusstsein beider Seiten, aber vor allem das der Braunschweiger geprägt, so Knopp. „Die Braunschweiger haben nämlich den Kürzeren gezogen im Laufe dieser jahrhundertelangen Konkurrenz, ihr anfängliches Übergewicht – sie hatten ein hervorragendes Blatt auf der Hand – hat sich im Laufe der Jahrhunderte in eine fast komplette Niederlage verwandelt, und beim Skat wie in der Wirklichkeit (auch in der politischen Wirklichkeit) trägt das niemand gerne und ohne Murren“, legte er das Braunschweigische Befinden recht schonungslos offen.
„Hannover war, als Braunschweig unter Heinrich dem Löwen seine große Zeit hatte, noch ein unbekannter Ort im Westen. Erst 1241 bekam es die Stadtrechte, und von wem? Vom Herzog Otto von Braunschweig! Braunschweig war die Residenz, war der politische Zentralpunkt des Welfenlandes. Bezeichnenderweise war Hannover ja auch jahrhundertelang gar kein Landesname, keine Territorialbezeichnung. Erst 1636 wurde Hannover Residenzstadt der Calenberger Welfen, und erst im 18. Jahrhundert begannen sich die Hannoveraner auch so zu nennen. Bis dahin waren sie eine der Ländereien des Hauses Braunschweig-Lüneburg. Noch Bismarck schrieb oft, wenn er Hannover meinte, von Kur-Braunschweig“, erläuterte der langjährigen Vorsitzende der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in seinem Festvortrag anlässlich der Verabschiedung von Nord/LB-Vorstandsmitglied Günter Nerlich 1983.
„Der Abstieg, den Braunschweig trotz aller Leistungen seiner Bürger und seiner Fürsten genommen hat und der einfach durch die historische Entwicklung bedingt war, hat im braunschweigischen Denken tiefe Wunden gerissen und bis heute nicht vernarben lassen. Bei vielen Entwicklungen, die vielleicht unausweichlich sind, aber zum Nachteil der Stadt und des Umlandes ausschlagen, hört man als resignierende Äußerungen immer wieder: Es läuft ja doch alles gegen Braunschweig“, führte Knopp aus.
Spätestens mit der Gründung Niedersachsens und der Ernennung Hannovers zur Landeshauptstadt haben sich die Kräfteverhältnisse endgültig gedreht. Schon mehrfach zuvor sei es in der Geschichte allerdings ganz dicht daran gewesen, so Knopp, dass die Trennung zwischen Braunschweig und Hannover aufgehoben worden wäre. So seien Ende des 16. Jahrhunderts die hannoverschen Kernlande und Braunschweig-Wolfenbüttel unter einem Zepter vereinigt gewesen, damals allerdings unter dem braunschweigischen. „Die Herzöge waren nur in den entscheidenden Jahren so ungeschickte Politiker, dass sie diesen hannoverschen Besitz nicht halten konnten und dass sich in der Folge die Hannoveraner auf Kosten der Braunschweiger ausdehnten“, so Knopp in seinem Beitrag zur Historie Niedersachsens.
1692 wurde Hannover schließlich Kurfürstentum des Deutschen Reichs. Die Braunschweiger hätten wie selbstverständlich angenommen, dass ihnen als ältere Welfenlinie dieser Status zustehe. Wahrscheinlich aufgrund diplomatischer Trägheit, so vermutete Prof. Dr. Knopp, sei dieser entscheidende Schritt den Braunschweigern verwehrt geblieben. Herzog Anton Ulrich verbrüderte sich daraufhin wütend mit Frankreich gegen Hannover, das daraufhin das Land Braunschweig-Wolfenbüttel besetzte und zur Räson brachte.
Das hannoversche Sonderbewusstsein sei sehr stark von der Zeit geprägt, als Hannover Königreich war. Das habe großes Selbstbewusstsein der Hannoveraner zur Folge. „Man muss darüber staunen, denn die Zeit, während ein hannoverscher König residierte, war außerordentlich kurz. Man kann sie relativ genau berechnen: Am 28. Juni 1837 traf der König Ernst-August in Hannover ein, und am 28. Juni 1866 musste sich König Georg V. bei Langensalza zur Kapitulation entschließen, die am nächsten Tag unterzeichnet wurde. Es sind also ziemlich genau 29 Jahre, welche die Könige von Hannover Zeit hatten, dem Lande und der Stadt ihren Stempel aufzuprägen, und sie haben das doch überraschend stark getan“, erläuterte Knopp am 12. Dezember 1983.
Braunschweig und Hannover wären wie zwei sehr ungleiche Brüder, die durch die Geschichte geprägt seien. Heute lebten sie beide im Lande Niedersachsen zusammen. Alle Niedersachsen, seien sie nun Oldenburger, Schaumburg-Lipper, Hannoveraner oder Braunschweiger, ähnelten sich doch soweit, dass man von einem halbwegs homogenen Land sprechen könne. So könne man denken, dass die Verhältnisse in Niedersachsen aufs harmonischste gestaltet seien, dass die Geschichte ganz zurückgetreten sei hinter dem Glücksfall dieser neuen Staatsschöpfung.
„Jeder nur oberflächliche Kenner unseres Landes Niedersachsen weiß natürlich, dass dem nicht so ist. Der dynastische Grund der Trennung von Hannover und Braunschweig hat nicht nur nicht verhindert, dass beide ein besonderes Bewusstsein entwickelt haben, sondern er hat kräftig dazu beigetragen. Auf jeden Fall bei der älteren Generation ist dieses Sonderbewusstsein auf beiden Seiten noch sehr stark ausgeprägt. Wie es bei den Jüngeren sein wird, wage ich nicht vorauszusagen. Aber dass ein Interessengegensatz zwischen Braunschweig und Hannover besteht, das haben auch viele der Jüngeren mitbekommen“, war sich Knopp sicher. Vor allen Dingen dadurch, dass Geschichte nicht nur durch gelehrte Bücher, sondern auch durch Erzählungen in der Familie und im Freundeskreise transportiert werde. Was der Großvater von seinen historischen Erlebnissen erzählt, das erinnere der Enkel bis an sein Lebensende und gebe es dann an seine Kinder weiter. Die Rivalität zwischen Braunschweig und Hannover als unendliche Geschichte.