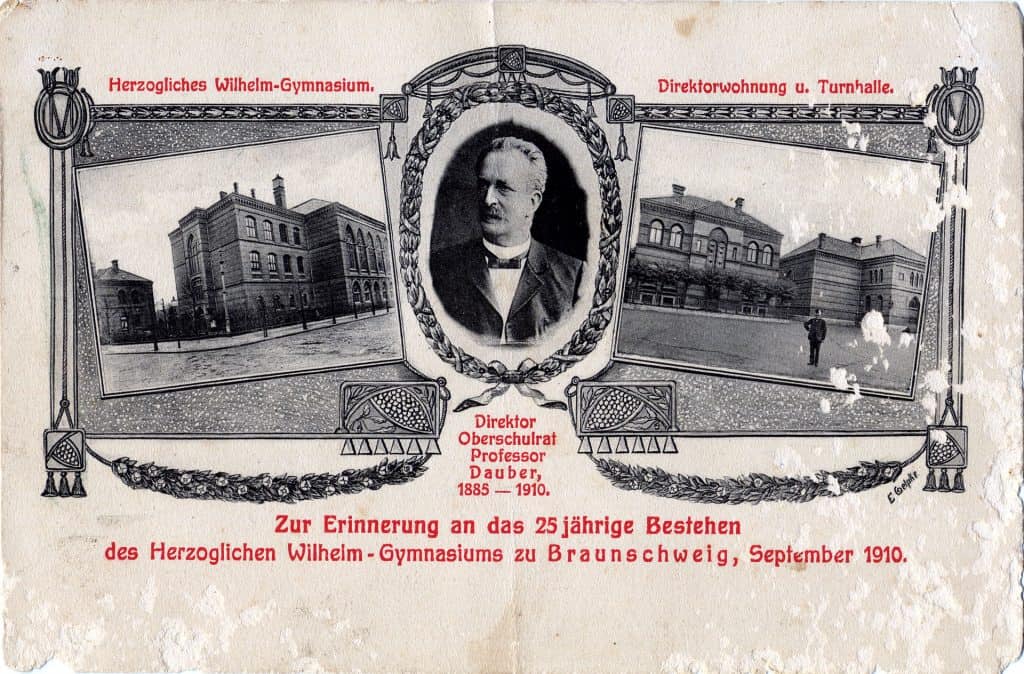Elftklässler der Neuen Oberschule und ein katholisches Gymnasium aus Łódź erforschen mit Hilfe der Gedenkstätte Schillstraße den Kriegsanfang 1939 in ihrer jeweiligen Heimatstadt.
Es ist ein Schülerprojekt, wie es nicht alle Tage vorkommt. Unter Federführung der Gedenkstätte Schillstraße in Braunschweig arbeiten ein Geschichtskurs der Neuen Oberschule und ein katholisches Gymnasium in Łódź (Polen) seit dem Sommer 2014 am Projekt „Braunschweig – Łódź 1939“. Bei dem von der Richard Borek Stiftung geförderten Forschungsprojekt geht es zum Beispiel um Unterschiede bei der Wahrnehmung der Kriegsvorbereitungen und beim Beginn des Zweiten Weltkrieges in beiden Städten, die rund 700 Kilometer voneinander entfernt liegen. Nach gegenseitigen Besuchen präsentieren die Braunschweiger Schüler und Lehrer voraussichtlich Ende Juni ihre Ergebnisse. Dies geschieht in Form einer hochwertigen Ausstellung.
Die Brücke von der Gedenkstätte Schillstraße / Braunschweig in das 1939 ganz im Osten Polens gelegene Łódź ist schnell geschlagen: Alle Insassen des Konzentrationslagers Schillstraße, in dem 1944 jüdische Häftlinge untergebracht waren, um bei der in unmittelbarer Nähe gelegenen Firma Büssing Zwangsarbeit zu leisten, hätten ursprünglich unter menschenunwürdigen Bedingungen im Ghetto in Litzmannstadt gelebt, weiß Gustav Partington, Geschichtslehrer an der Neuen Oberschule. Aus Lodz war Litzmannstadt geworden, nachdem deutsche Truppen 1939 Polen überfallen hatten. Im dortigen Ghetto wohnten 1940 über 150.000 Juden. Aber auch Sinti und Roma lebten in Łódź im Ghetto. Von Łódź war es für die KZ-Häftlinge zunächst nach Auschwitz gegangen, dort hätten sich Mitarbeiter der Firma Büssing Arbeitskräfte für die Kriegsproduktion in Braunschweig ausgesucht, so jedenfalls der Forschungsstand.
„Wie unterschiedlich haben sich die Menschen in Braunschweig und Lodz auf den drohenden Krieg vorbereitet? Wie haben sie nach Kriegsausbruch reagiert? Aber auch, wie sind sie mit Minderheiten anschließend umgegangen, lauteten die Fragen, die sich die beiden Schülergruppen gestellt haben“, berichtet Partington, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Andere Geschichte e.V., der mit 13 Schülerinnen und Schülern vom 13. bis 18. April 2015 zum Besuch in Łódź war. In der 700.000 Einwohner zählenden und heute aufgrund der Nachkriegsgeschichte in der Mitte Polens liegenden Stadt wurde auch die Ausstellungskonzeption erarbeitet. Dort soll die Ausstellung, die mit der aus Braunschweig identisch ist, im September eröffnet werden. Gustav Partington: „Das war eine sehr arbeitsreiche, aber auch sehr harmonische Woche in Polen, bei der viele Freundschaften entstanden sind.“ Untergebracht waren die NO-Schüler in Gastfamilien, eine Schülerin sogar im Klosterinternat der Privatschule.
Die Schulleitung des Braunschweiger Gymnasiums hatte dafür gesorgt, dass zum Projekt „Braunschweig – Łódź 1939“, das im Rahmen von „Europeans for Peace“ stattfindet, extra einen Kurs eingerichtet wurde. 28 hochmotivierte Elftklässler meldeten sich an. Als Arbeitsgrundlage diente den Braunschweiger Schülerinnen und Schülern eine Arbeitsmappe mit Quellen, Literatur und Hilfsmittel. Diese hatten die Historikerinnen Kirsten Julia Bergmann und Sabine Ahrens und der Historiker Jonathan Voges erarbeitet.
Ende Oktober 2014 hatten 13 Schüler des Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II die Stadt Braunschweig besucht. Einer der Höhepunkte der Arbeitswoche war die Begegnung mit Sally Perel. Dessen Lebensgeschichte geht unter die Haut: Der heute 90-Jährige hatte als polnischer Jude den Nationalsozialismus überlebt, weil er die Identität gewechselt hatte. Als Josef Peters war der in Peine geborene Perel sogar Mitglied der Hitlerjugend (HJ) und arbeitete als Lehrling im so genannten Vorwerk von Volkswagen in Braunschweig. Seine Biografie „Hitlerjunge Salomon“ ist weltbekannt und wurde 1990 verfilmt. Aber auch der Historiker Dr. Karl Liedke gab einen Einblick in das Thema Zwangsarbeit.
16 Schautafeln werden derzeit von den Schülergruppen in Braunschweig und Łódź erstellt. Die Arbeiten erfolgen autonom. Die Łódź-Schüler haben einen Schwerpunkt in der Zeitzeugenbefragung gelegt. Eine Grafikerin aus Polen gestaltet die zweisprachige Ausstellung, die ab Ende Juni in der Gedenkstätte Schillstraße, die von Frank Ehrhardt, Geschäftsführer des Arbeitskreises Andere Geschichte e.V. betreut wird, zu sehen sein wird. „Alle Schüler machen dies alles völlig freiwillig und aus Interesse an der NS-Geschichte“, erklärt Partington. „Für mich ist es wirklich eine Riesenfreude zu sehen, dass alle Beteiligten so toll mitziehen.“
Weitere Informationen: