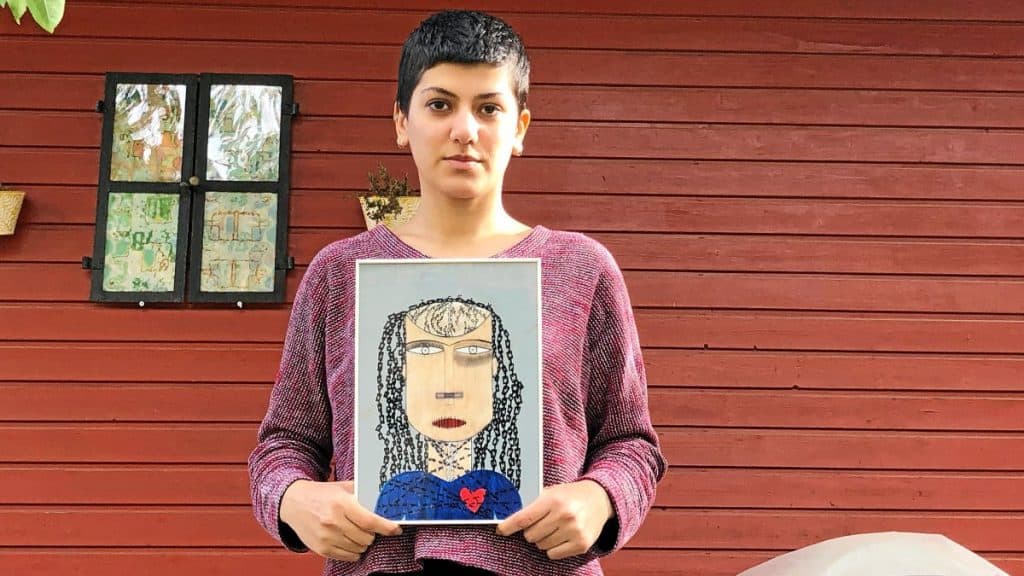275 Jahre Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Folge 4: Ein neuer Anfang nach der Franzosenzeit.
Die Wiedererrichtung des Herzogtums Braunschweig nach der Befreiung von der französischen Herrschaft 1813/1815 löste Jubel bei der Bevölkerung, aber auch Nachdenklichkeit aus. Sollte nun wieder alles anders werden, musste man sich erneut ganz umstellen oder wurden die Zeiten nun unsicher? Manche Neuerung, besonders im Justizbereich, war während der Franzosenzeit eingeführt und begrüßt worden. Nun war es vorherzusehen, dass das Rad der Geschichte nicht einfach zurückgedreht werden konnte, sondern der Blick – trotz restaurativer Tendenzen – nach vorn zu richten war. Besonders im Bildungsbereich und damit auch für den Vorgänger der heutigen Technischen Universität galt es, Probleme zu lösen.
Sehr rasch waren die Verantwortlichen sich darüber einig, dass die Universität Helmstedt nicht wieder eröffnet werden sollte, die Konkurrenz etwa von Göttingen oder Halle war zu groß. Ebenso naheliegend war die Schließung der von den Franzosen anstelle des Collegium Carolinum eingerichteten Königlich-Westphälischen Militärschule. Mit dem traditionsreichen Collegium Carolinum war hingegen die Möglichkeit geboten, zu relativ überschaubaren Kosten ein zentrales Bildungsinstitut wieder zu eröffnen.
Wesentliche Neuerungen nach 1814
Das Reskript zur Wiedereröffnung vom 6. September 1814 lässt sowohl die Kontinuität als auch wesentliche Neuerungen erkennen: „Es hat dieses Institut dem gedoppelten Zweck, …
1) diejenigen jungen Leute, welche sich den Wissenschaften bestimmen, für den höheren Unterricht der Universität auf eine solche Art vorzubereiten, dass sie dadurch, und durch eine auf diesem Institute erworbene Umsicht ihres künftigen Fachs, in den Stand gesetzt werden, den höheren Unterricht schneller zu fassen und der fortdauernder Benutzung desselben, wenn es andere Rücksichten erlauben oder nothwendig machen, um ein Jahr den gewöhnlichen dreyjährigen Cursus abzukürzen. Es soll aber auch dieses Institut
2) einem Jeden, dem es erstlich darum zu thun ist, durch mannichfaltige, gründliche und gemeinnützliche Kenntnisse und Fertigkeiten sich nicht allein zu irgend einem untergeordneten bürgerlichen Amte oder Staatsdienste brauchbar zu machen, sondern sich zugleich den höhern Werth eines durch ächte Humanität und Sittlichkeit zum feinern geselligen Leben wahrhaft und vielseitig gebildeten Mannes zu verschaffen […] Die Aufnahme der Landeskinder in dieses Institut kann nur nach einer vorgängigen Prüfung von einem durch die Directoren angeordneten engern Ausschuß der aus den verschiedenen Fächern zu erwählenden Lehrer statt finden […] Um übrigens den Unterricht in mehreren Fächern, besonders der Natur-Geschichte, der Archäologie und der schönen Kunst anschaulich und dadurch anziehender zu machen, soll es den Lehrern gestattet sein, in gewissen Stunden der einmal festgesetzten Tage mit einer Auswahl ihrer Zöglinge das Kunst- und Naturalien-Cabinet zu besuchen, und solches für die Bildung derselben auf die beste Art zu benutzen.“
Erstes öffentliches Museum
Das Kunst- und Naturalienkabinett befand sich damals in den Räumen des alten Zeughauses. An der Stelle steht heute das Gebäude der ehemaligen Bezirksregierung. Ausgangspunkt für diese damals besondere Möglichkeit der Studenten war das 1754 von Carl I. eröffnete Museum, das zunächst im ersten Stock der ursprünglichen Burg Dankwarderode untergebracht worden war. Es war das erste öffentliche Museum in Deutschland. 1857 wurden die Kunst- und Naturkundesammlung getrennt (heute Herzog Anton Ulrich-Museum und Naturhistorisches Museum). Die naturkundliche Lehrsammlung des Collegium Carolinums wurde in dem Zuge mit der Naturkundesammlung des Herzoglichen Naturhistorischen Museum vereinigt. Im Schloss war das Naturkundemuseum schließlich von 1921 bis 1937 untergebracht. Danach zog es in den damaligen Neubau an der Pockelsstraße und blieb glücklicherweise von Kriegsschäden verschont. Dort ist bekanntlich auch heute noch der Standort des Naturhistorischen Museums. Die beliebten Dioramen entstanden in den 1950er Jahren und sind besondere Anziehungspunkte.
Verbesserte konzeptionelle Grundlage
Das Collegium Carolinum wurde also mit verbesserter konzeptioneller Grundlage am 17. Oktober 1814 wieder eröffnet. Diese neue Konzeption schien sich zunächst auch zu bestätigen. So schrieben sich 1814 sogleich 61 Studenten ein, eine für die Verhältnisse des Collegium ausgesprochen große Anzahl, die in der Folge jedoch auf durchschnittlich 40 Studenten zurückging. Entscheidend verändert haben sich in dieser Zeit die sozialen Grundlagen der Studenten, denn nun war bei der Herkunft vieler Caroliner festzustellen, dass sie aus dem einfachen bürgerlichen Milieu abstammten. Kinder von Handwerkern, Kaufleuten oder Gastwirten erhofften sich einen sozialen Aufstieg über den Bildungsweg.
Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.