Brage Bei der Wieden und der Braunschweigische Geschichtsverein legen Band 104 des Braunschweigischen Jahrbuchs vor.
Das Braunschweigische Jahrbuch, das die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz in Kooperation mit dem Braunschweigischen Geschichtsverein herausgibt, ist das Medium der wissenschaftlichen Regionalgeschichte. Das Themenspektrum spannt sich vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert und schließt alle Aspekte der historischen Forschung ein. Jetzt ist Band 104 erschienen. Herausgeber ist Brage Bei der Wieden, Leiter der Abteilung Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs. Der Band hat 224 Seiten, zahlreiche, Abbildungen und kostet im Buchhandel 25 Euro.
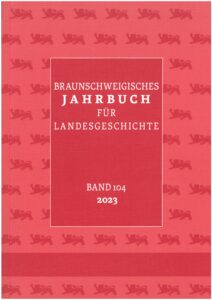
Regionale Identität stärken
Der Braunschweigische Geschichtsverein wurde am 6. Mai 1901 als „Geschichtsverein für das Herzogtum Braunschweig“ gegründet und hat heute international etwa 500 Mitglieder. Ziel des Vereins ist die Förderung des historischen Bewusstseins und einer regionalen Identität der heutigen Region zwischen Harz und Heide und Harz und Weser.
Die Mitglieder des Geschichtsvereins erhalten die Jahrbücher kostenlos. Die Ausgaben gelangen im Schriftentausch an 205 Institutionen im In- und Ausland, darunter die Akademien der Wissenschaften in Göttingen, München, Stockholm und Prag und die Bodlein Library in Oxford. Lediglich von 1916 bis 1922 wegen des Ersten Weltkriegs und seiner Folgen, von 1943 bis 1949 wegen des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen sowie aus unterschiedlichen Gründen 1915, 1928, 1932 und 1939 erschien das Jahrbuch nicht.
Um das Jahr 1030 gefertigt
In diesem Band ist die Kunstgeschichte mit Beiträgen von Katharina Beichler zu den Ringen am Armreliquiar des heiligen Blasius und Lars Berg über das Werk des Braunschweiger Hofkupferstechers Carl Schröder stark vertreten. Das Armreliquiar des Heiligen Blasius zählt zum berühmten Welfenschatz. Die brunonische Gräfin Gertrud die Ältere von Braunschweig hatte es um das Jahr 1030 für den Vorgängerbau der Residenz von Heinrich dem Löwen anfertigen lassen. Es ist im Knappensaal der Burg Dankwarderode zu sehen. Dort befindet sich die mittelalterliche Abteilung des Herzog Anton Ulrich-Museums. Schröder (1760–1844) zeichnete und stach meist Gemälde der Salzdahlumer Galerie, Porträts der Braunschweiger Fürstenfamilie sowie Ansichten aus der Umgebung Braunschweigs.
Objekte betrachten auch Hennig Steinführer in seinem Bericht über „Neue Forschungen zu Wappen und Siegel der Stadt Braunschweig im Mittelalter“, Antje Becker in ihrer Untersuchung einer Bogenklaviatur der Firma Grotrian-Steinweg oder Gerhard Aumüller und Wiebke Kloth in zwei Aufsätzen zu Gigantenskeletten und ‑porträts, die früher zum Theatrum medicum der Universität Helmstedt gehörten. Eine grundlegende Darstellung widmet Malte de Vries dem Hebammenwesen im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Dort gab es ungewöhnlich frühe Regelungen und Professionalisierungsbestrebungen.
Zum Weltkulturerbe erklärt
Ein kleiner Beitrag zur Wirkung, die der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bote (1450–1520) mit zwei politischen Liedern erzielte, ein Überblick über Verkündung von Gesetzen und Verordnungen im Land Braunschweig, beide von Brage Bei der Wieden, und die Vorstellung der Braunschweiger „Tohopesate“ von 1476, einer Urkunde, die als Teil ausgewählter Quellen zur Hansegeschichte zum Weltkulturerbe erklärt worden ist, komplettieren den Band.
Bote gilt als Autor der 96 Historien über Till Eulenspiegels. Auf Botes Autorenschaft deuten Initialen im ersten Eulenspiegelbuch von 1515 hin. Und bei der Urkunde handelt es sich um das Dokument eines Bündnis- und Hilfeleistungsvertrags zwischen 19 Hansestädten, darunter Braunschweig. Er wurde zur Verteidigung der Handelsinteressen gegen einen politischen oder militärischen Gegner geschlossen.
Zudem werden neue Veröffentlichungen zur braunschweigischen Landesgeschichte in kritischen Rezensionen vorgestellt. Der Band schließt mit einer Analyse der Situation des Braunschweigischen Geschichtsvereins, wie sie für andere historische Vereine bisher noch nicht vorgenommen worden ist. Autor ist Philip Haas, Archivrat des Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Wolfenbüttel.
Die Bände von 1902 bis 2021 sind digital einzusehen unter: https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/receive/dbbs_mods_00064800
Kontakt:
Braunschweigischer Geschichtsverein e. V.
Forstweg 2 (Landesarchiv)
38302 Wolfenbüttel
Telefon: 05331–935245 (9.30 – 13.30 Uhr)
Internet: www.bs-gv.de
Mehr:
Starken Worten folgten keine Taten



