Allgemein

Kraftsymbol für das Braunschweiger Land
Aus dem Stadtarchiv, Folge 3: Gegen 1166 ließ Herzog Heinrich das Löwenmonument als selbstbewusstes Zeichen seiner Ansprüche errichten. Weiterlesen
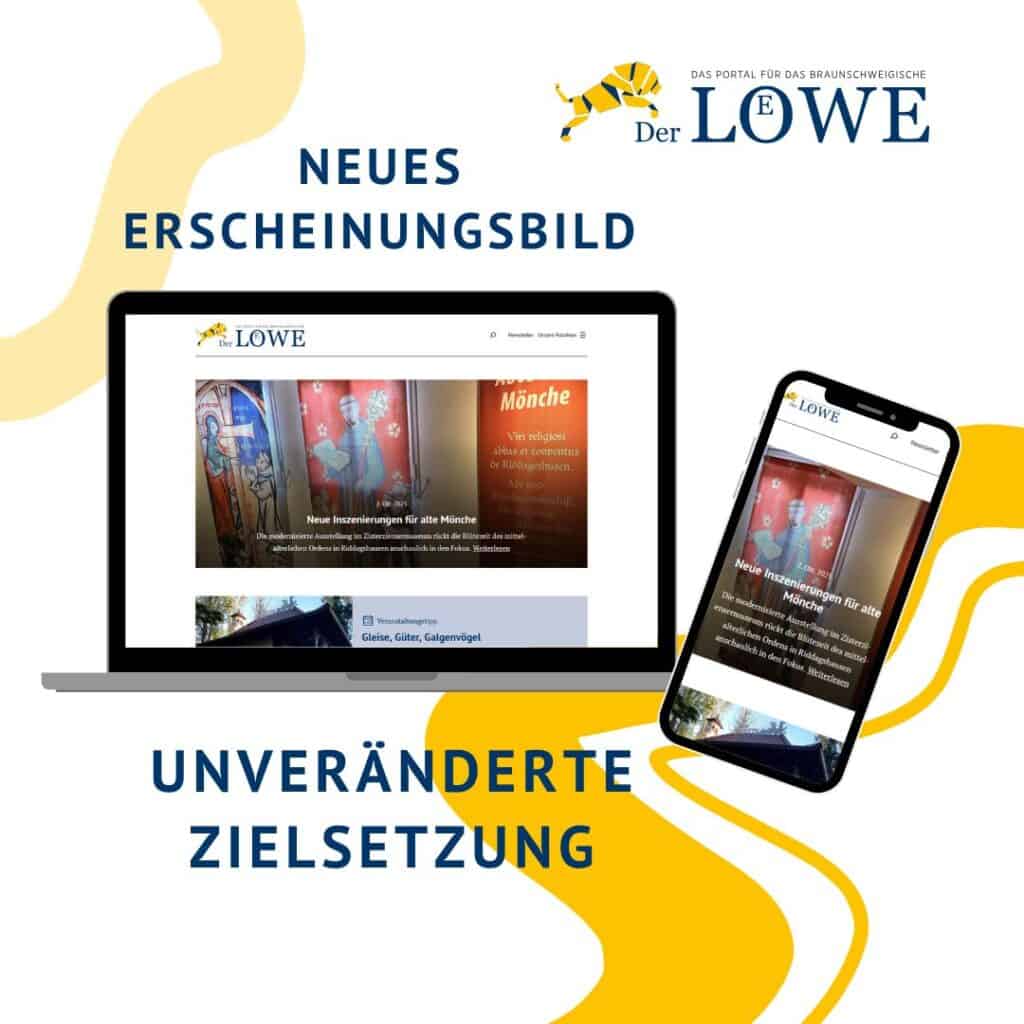
Neues Erscheinungsbild, unveränderte Zielsetzung
Die Richard Borek Stiftung führt „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ künftig alleine fort – mit neuem Design. Weiterlesen

Braunschweigs koloniale Verbindungen: Von der Oker in die Welt
Braunschweig war Anfang des 20. Jahrhunderts kulturell, wirtschaftlich und politisch mit den europäischen Kolonien vernetzt. Der Historiker Clemens Janke hat Quellen zu Braunschweigs kolonialem Erbe erschlossen. Ein Einblick anhand von drei Beispielen. Weiterlesen

„SOS für alte Fachwerkhäuser“
In den frühen Nachkriegsjahren stand den Menschen der Sinn nicht nach Denkmalpflege. Ein Rückblick. Weiterlesen

Gebäude mit großer Tradition und ungewisser Zukunft
Geschichte(n) von nebenan, Folge 3: Das Große Weghaus in Braunschweig-Stöckheim hat eine lange Geschichte in der herzoglichen Residenzlandschaft. Jetzt steht es zum Verkauf. Weiterlesen

Gleise, Güter, Galgenvögel
Der Verein Forum Industriekultur sorgt vom 18. bis. 20. Juli im Rahmen der „WRG Kulturtage“ in und am Braunschweiger Kontorhaus am Jödebrunnen für vielfältige Unterhaltung und Information. Weiterlesen

Blockflötenorchester feiert Erfolge – Jubiläumskonzert am 29. Juni in der Dornse
Frisch ausgezeichnet beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2025 in Wiesbaden zeigt das Blockflötenorchester „Recording Generations“ der Städtischen Musikschule Braunschweig sein Wettbewerbsprogramm am Sonntag, 29. Juni, um 12 Uhr in der Dornse des Altstadtrathauses. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des Ensembles „Recording Artists“ – ein Jubiläum, das Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und das Publikum gemeinsam feiern. Unter der… Weiterlesen

Weltweit einzigartiger Wissensspeicher für Schulbücher
„Ich möchte Schulbücher für den Geschichtsunterricht untersuchen – hätten Sie da etwas?“ Diese Frage kann Kathrin Henne vom Informationszentrum Bildungsmedien am Georg-Eckert-Institut mit einem definitiven „Ja!“ beantworten. Über einen einmaligen Forschungsort mitten in Braunschweig. Weiterlesen

Frühjahrsgrüße auf Holz
Objekt des Monats, Folge 13: Der mit Tulpen verzierte Schrank der letzten Äbtissin von Gandersheim. Weiterlesen

Das doppelte Jubiläum der Klosterkirche Riddagshausen
Doppelter Grund zum Feiern für die Klosterkirche: Vor 750 Jahren wurde sie geweiht, vor 50 Jahren wurde sie vor dem Abriss gerettet. Weiterlesen