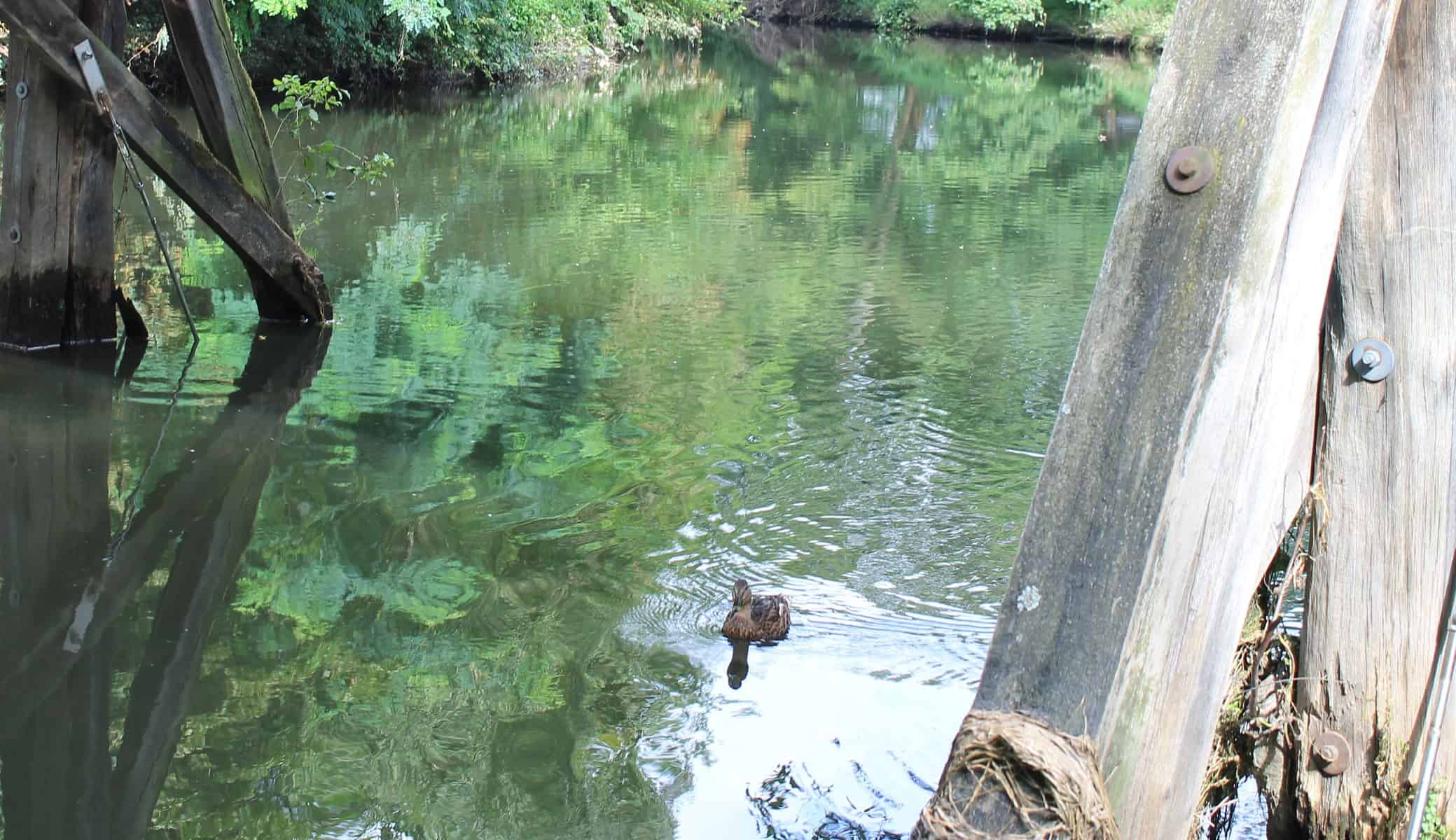Braunschweigs skurrile Ecken und andere Merkwürdigkeiten, Folge 31: vom Hakemann, dem Krokodil und neugierigen Männerblicken.
Die Oker hat die Entstehung Braunschweigs vom 9. Jahrhundert an entscheidend geprägt. Und natürlich ranken sich um ein solches Gewässer zahlreiche Legenden und Geschichten. Da geht es um den Hakemann, der Menschen vom Ufer in den Untergrund zog. Angeblich hatte sich sogar ein Krokodil in die Oker verirrt. Ganz Verwegene behaupten sogar, dass über die Oker transportierte Braunschweiger Mumme bei der Entdeckung Amerikas eine Rolle gespielt haben könnte. Und natürlich gibt es eine Reihe von Anekdoten, als Männer und Frauen noch getrennt baden mussten.
Heute ist die Oker zwischen Eisenbütteler Wehr und dem Oker-Düker bei Watenbüttel längst zum Wassersport- und Freizeitort. Es gibt ein umfangreiches Ausflugsprogramm mit allerlei kulturellen und kulinarischen Angeboten sowie kundigen Flößern, die ihre Gästen mit dem Skurrilen rund um die Oker bei Laune halten. Erwähnt werden soll von den Veranstaltungen die schon 2002 gestartete Reihe „Mord auf der Oker“, die in jedem Jahr durch eine Reihe von Autoren mit ihren Kriminalromanen viele Besucher begeistert. Eine Floßfahrt ist jedenfalls eines der schönsten Erlebnisse, das ein Tourist in Braunschweig haben kann.
Die Oker entspringt auf ca. 910 m Höhe auf dem Bruchberg im Harz und kommt mit großer Fließgeschwindigkeit nach Braunschweig. Nach 125 Kilometern mündet sie bei Müden in die Aller. Ursprünglich floss sie in einer 200 bis 500 Meter breiten Talaue in nördlicher Richtung durch das heutige Stadtgebiet. In Braunschweig bildeten sich im 9. Jahrhundert erste Ansiedlungen an einer Okerfurt, über die wichtige Fernstraßen führten.
Schifffahrt
Wenn auch immer wieder die Rede vom „alten Handelsweg“ Oker-Aller-Weser ist, so gilt das doch nur mit Einschränkungen. Heinrich der Löwe hatte den Kaufleuten in der Stadtrechtsurkunde des Weichbildes Hagen zugesagt, dass sie das Recht der freien Schifffahrt auf dem Wasserweg bis Bremen hätten. Tatsächlich gibt es aber kaum Nachrichten über die Nutzung zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert. Es gab von Seiten des Rates in Celle immer wieder Forderungen von Abgaben für die Schiffe, später gab es Probleme mit Lüneburg, weil man die Oker für die Verschiffung von Korn und anderen Waren nutzen wollte.
Erst im 18. Jahrhundert wird ein neuer Versuch unternommen, die Oker durch einen Ausbau verstärkt für den Transport zu nutzen. Doch die regelmäßige Versandung der Oker sowie rutschende Böschungen bedingten schon sehr schnell den täglichen Einsatz eines Baggerschiffes. Herzog Carl ließ zudem 1745 südlich von Wolfenbüttel mehr als 1000 wirtschaftlich wertvolle Weidenbäume fällen, um Treidelpfade zu schaffen. Man transportierte von Hedwigsburg bei Halchter bis Braunschweig auf dem Wasserweg Bruchsteine und Holz aus dem Harz, auf einem schon im 15. Jahrhundert gebauten Kanal von Ösel ebenfalls Bruchsteine. Unproblematisch war die Schifffahrt auf der Oker nie, weil sie oft zu flach war und mit Schleusen und Zuleitungen aus Bächen gearbeitet werden musste, um den Wasserstand zu regulieren. Die teilweise großen Untiefen deuten nicht auf die frühere Schiffbarmachung hin, sondern sind Bombentrichter aus dem II. Weltkrieg.
Okerhäfen
Im südlichen Bruchgebiet bei Stöckheim bestand ein Hafen, in dem die Besatzungen der Schiffe ausgewechselt wurden, der Straßenname „Am Schiffhorn” weist noch darauf hin. Für 1753 sind 489 Fahrten dokumentiert, die überwiegend Bier, Brot und Baustoffe beförderten. Insbesondere beim Bier wurde nachweislich von Schiffsbesatzungen „genascht”, was aus Gerichtsakten hervorgeht.
Der Braunschweiger Hafen lag also zunächst am Bruch (mit Kran und Güterschuppen), danach im Beginengarten des Johannisstifts (heute etwa Kattreppeln/Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße). Nach dem Bau der Oker-Umflutgräben im späten 18. Jahrhundert wurde dem Innenstadthafen dann das Wasser entzogen. Seit etwa 1900 wird die Oker unterirdisch durch die Stadt geführt.
Trinkwasser
Das Wasser der Oker war als Trinkwasser nur sehr bedingt verwendbar, denn die Stadt leitete alle Abfälle hinein, allerdings wird berichtet, dass zum Bierbrauen das Okerwasser wieder Verwendung fand – die Anekdote vom Stadtschreier, der durch die Gassen ging und angeblich ausrief, man möge heute nicht mehr in die Oker….machen, weil morgen wieder frisch gebraut würde, ist dadurch entstanden. Im 16. Jahrhundert organisierten sich verschiedene „Pipenbruderschaften“ (Pipe = Röhre), die nach und nach ein System mit hölzernen Rohren aufbauten, das mehr als 300 Jahre lang fließendes Wasser in die Häuser der Stadt lieferte. So wurden etwa zehn Prozent der Häuser mit fließendem Wasser für das Bierbrauen und als Brauchwasser versorgt. Die Quelle war der Jödebrunnen außerhalb der Stadtmauern.
Industriedenkmal
1865 wurde die „Wasserkunst“ im Bürgerpark eröffnet. Mit Hilfe von mehreren Filtervorgängen, u.a. durch Sand und dem Druckwerk, von dem heute noch der Förderturm und das Maschinenhaus als Industriedenkmal beim Steigenberger Hotel stehen und zu dem auch die Kennelteiche gehörten, gelang es, das Flußwasser als Trinkwasser aufzubereiten. Konstrukteur der Anlage war der Eisenbahningenieur Clauss.
Nutrias
Heute ist das Okerwasser nicht etwa braun und trüb, wie man bei einer Bootsfahrt annehmen könnte, denn man sieht durch das kristallklare Wasser auf den schlammigen Untergrund. Das Wasser hat Trinkwasserqualität der Stufe 2 und ist somit trinkbar. Außerdem leben zahlreiche Fischsorten, eine seltene Krötenart und neben den Ratten auch die biberartigen Nutrias hier.
Badevergnügen
Schon von 1783 – 1809 gab es eine Badeanstalt auf einem Floß in der Oker. 1813 entstand die Schwimmanstalt für die gebildeten Stände Magnitor, 1859 die kostenlose „Freibadeanstalt“ für arme Männer. Ab 1874 war für die Öffentlichkeit die „Bahnbade“ zugänglich, die sich an der Stelle befand, an der heute alljährlich im Bürgerpark die Okercabana entsteht. Nach dem Krieg wurde sie noch von 1947–1952 betrieben, dann aber geschlossen. Eine Schwimmbadeanstalt nur für Frauen wurde 1909 von der Stadt eingerichtet, Familienbäder entstanden erst nach dem 1. Weltkrieg, 1927 gab es vom Schwimmverein Delphin ein Bad an der Oker bei Melverode. Viele Okerflußbäder wurden privat von Bademeistern betrieben und erweckten rasch Konkurrenzneid untereinander.
Neugierde
Als es endlich ein Flußbad nur für Frauen gab, wurde berichtet, dass plötzlich kein Paddelboot auf der Oker mehr zu mieten war, weil sich zahlreiche Männer auf den Weg gemacht hatten, um die badenden Frauen vom Boot aus zu beobachten. Doch dem schob der Bademeister rasch einen Riegel vor, spannte zwischen Bäumen eine Leine und legte große Laken darüber, die bis ins Wasser hingen – und schon hatten die Damen einen Sichtschutz.
Krokodil
Eine weitere Anekdote berichtet, dass sich ein Betreiber der Badeanstalt unterhalb der Badetwete/Wolfenbütteler Straße über die ausbleibenden Besucher trotz des schönen Wetters wunderte. Als er nach oben zur Straße ging, um Ausschau zu halten, entdeckte er ein Schild mit der Aufschrift „Warnung vor dem Oker-Krokodil!“, das vermutlich von einem Konkurrenten aufgestellt wurde. Der Mann war jedoch pfiffig, besorgte sich das als Dekoration in einer Apotheke unter der Decke hängende Krokodil, dazu einen Reporter einer der hiesigen Zeitung, ließ sich mit dem toten Tier ablichten und stolz verkünden, man hätte das Reptil erlegt. Die ersten Badegäste nach diesem Ereignis hätten aber vor dem Baden kräftig auf die Wasseroberfläche geschlagen. Das war jedoch nicht die einzige Gefahr in der Oker!
Hakemann
Kindern wurde immer wieder die Schauerstory vom „Hakemann“ erzählt, der wie eine Nixe einen menschlichen Oberkörper und einen Fischleib als Unterkörper habe. Hatte der Hakemann Hunger auf Menschen, so zog er die vom Ufer mit seinem Hakenstock ins Wasser und fraß sie auf. Allerdings vergriff er sich nie an Schwimmern oder Badenden, deshalb sollte jedes Kind schwimmen lernen, um ihm zu entgehen. Der Hakemann lebt in Brunnen wie in Teichen und Flüssen, er ist in ganz Deutschland bekannt und wurde schon 1901 in der „Braunschweiger Volkskunde“ erwähnt.
Fotos