Highlight

Ihm gelang der erste Senkrechtstart einer Rakete in Europa
Geschichte(n) von nebenan, Folge 5: Raketenpionier Johannes Winkler. Weiterlesen

Moderne Nutzung für das alte Bankhaus
Perschmann Property Management hat das Gebäude Bankplatz 6 erworben und wird es denkmalgerecht sanieren. Was ist geplant? Weiterlesen
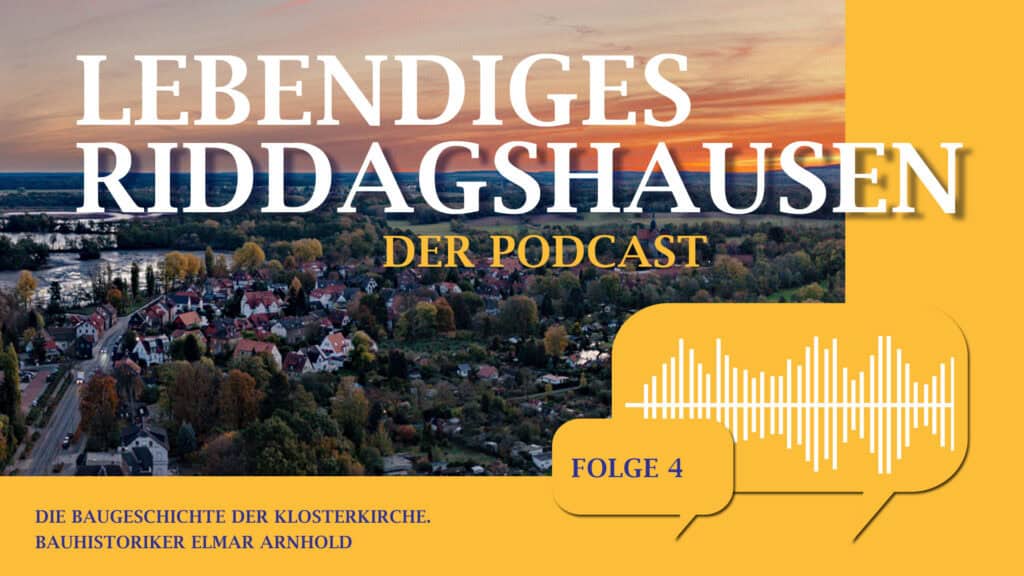
60 Jahre Bauzeit für die Klosterkirche
Folge 4 unserer Podcast-Reihe „Lebendiges Riddagshausen“. Heute: Bauhistoriker Elmar Arnhold über den Bau der Klosterkirche. Weiterlesen

Lack-Luxus aus Braunschweig
Objekt des Monats, Folge 21: Eine Schreibkommode aus Deutschlands berühmtester Lackwarenmanufaktur. Weiterlesen

„Von Republik zu Diktatur und Zusammenbruch“
Wissenschaftliche Tagungen des Stadtarchivs zur Stadtgeschichte. Weiterlesen
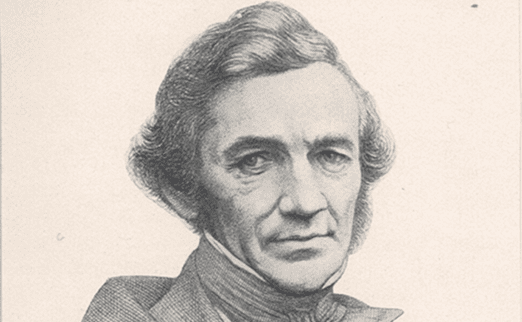
Das Lessing-Denkmal war sein epochemachendes Werk
Ehrenbürger der Stadt Braunschweig, Folge 4: Ernst Rietschel. Weiterlesen

„Nicht wegsehen, sondern ertragen“
Jubiläums-Gottesdienst und -Empfang anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Hospiz Stiftung für Braunschweig. Weiterlesen

Zeitgenössische Auseinandersetzung mit Stobwasser
Am 13. November startet die Vortragsreihe „Stobwasser – ganz schön gelackt“ im Städtischen Museum. Weiterlesen

Gräberfeld erinnert an die Schrecken des Ersten Weltkriegs
Vor 111 Jahren begann das große Sterben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Seine Spuren sind auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof sichtbar. Weiterlesen

Braunschweigs Baumeister
Herzogliches Kalenderblatt, Folge 12: Erinnerungen an Peter Joseph Krahe. Weiterlesen